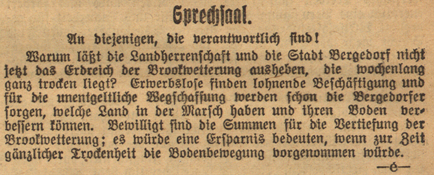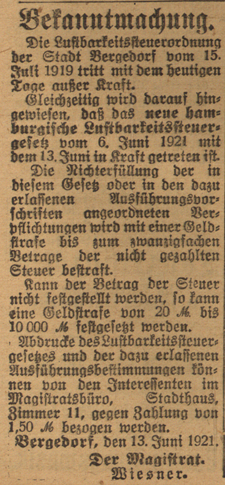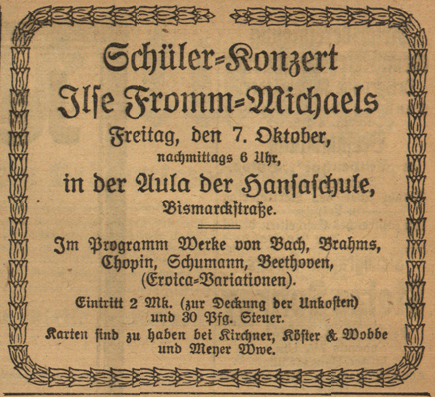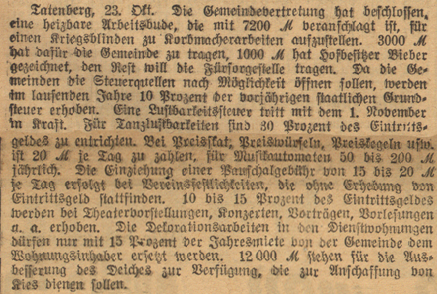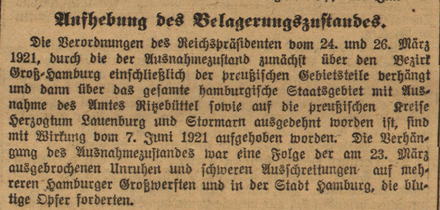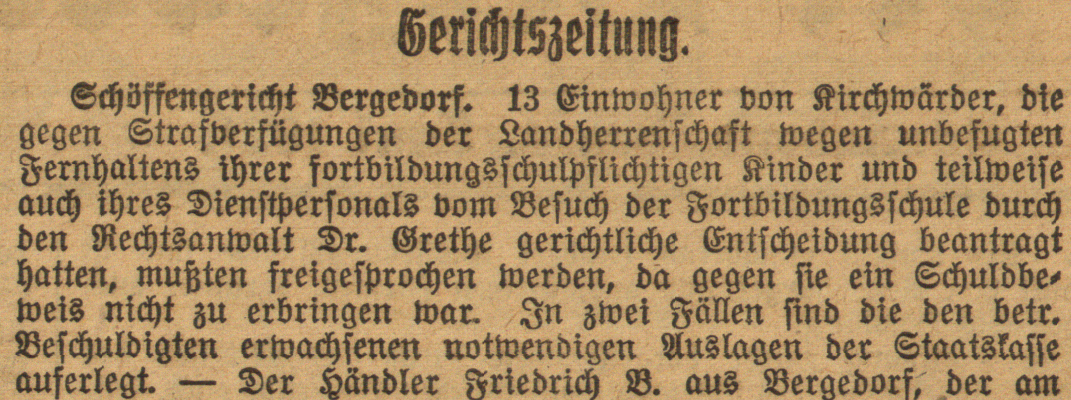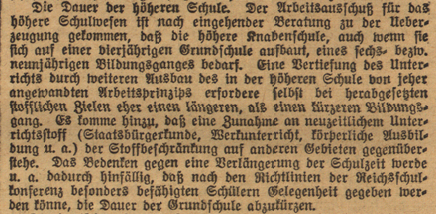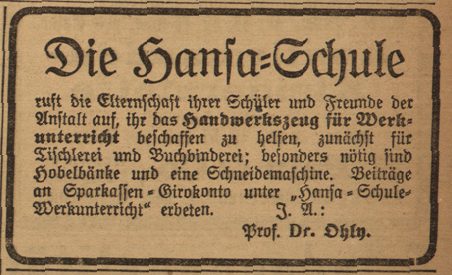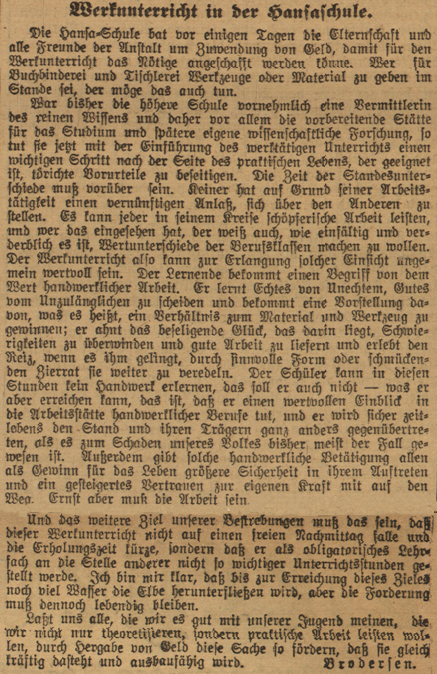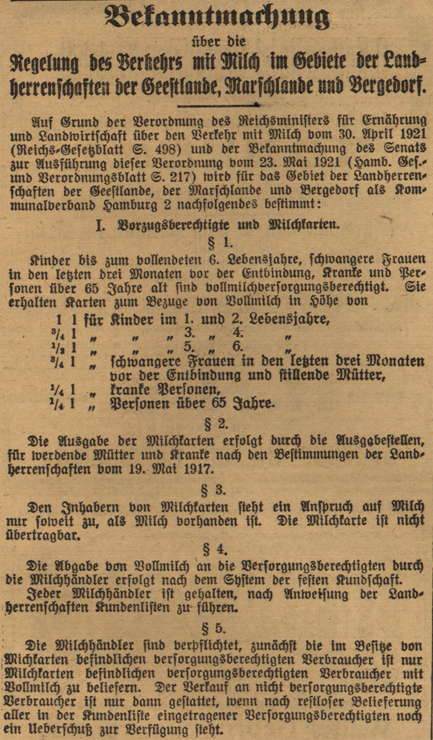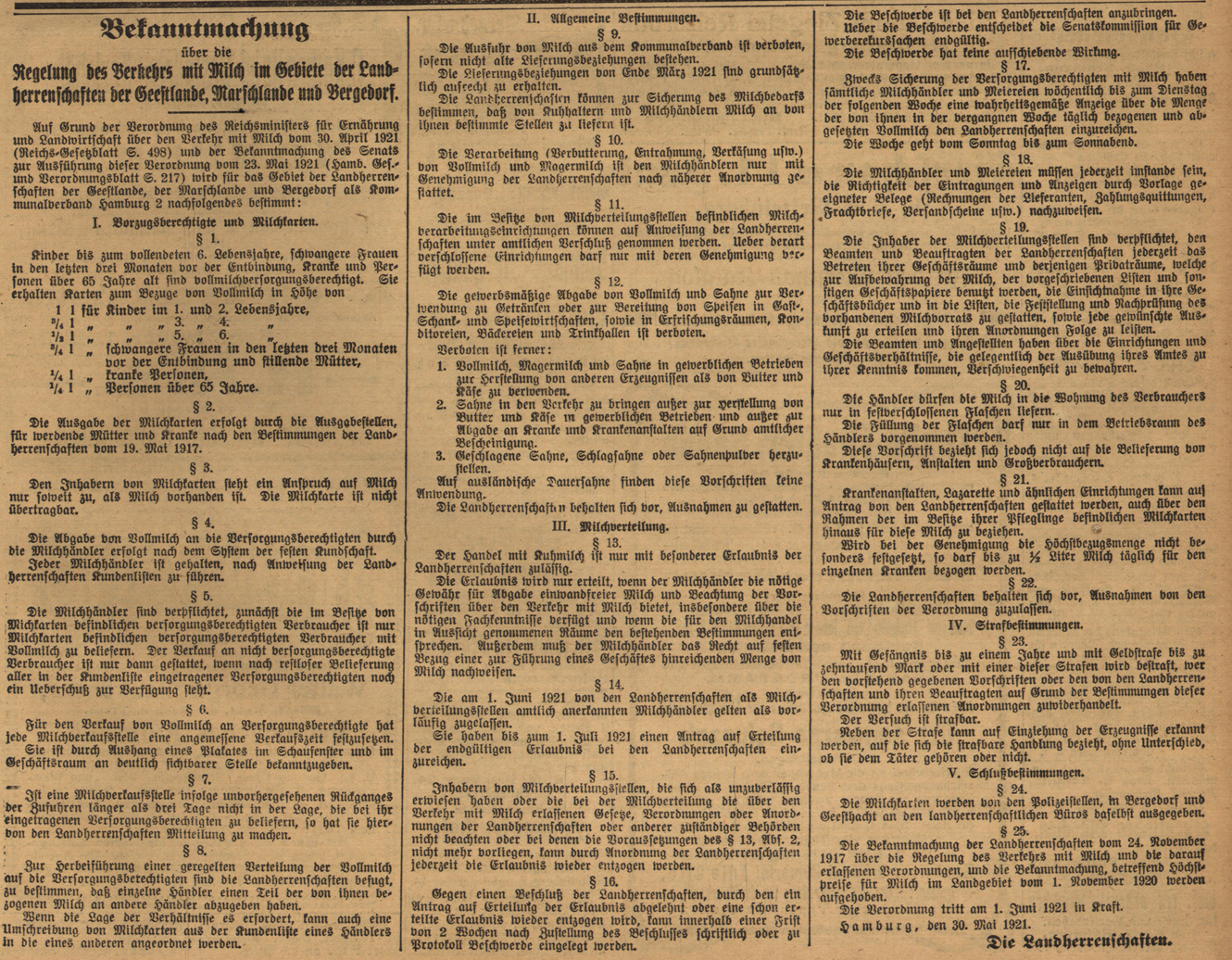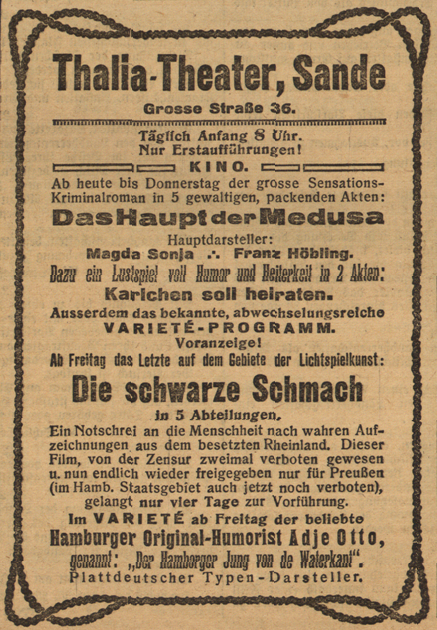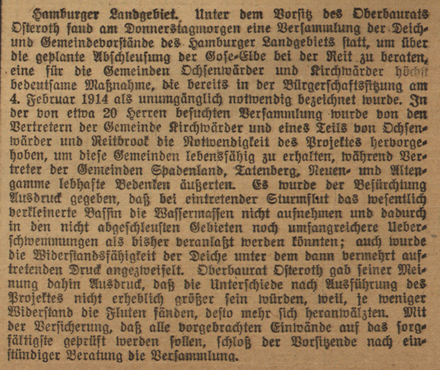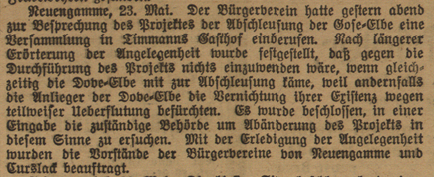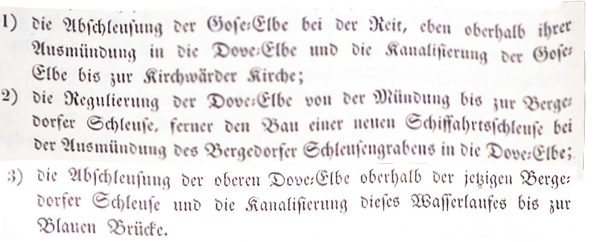Ein Gesetz für einen einzelnen Graben und eine Bewilligung von 100.000 Mark für nötige Arbeiten an diesem – das war schon ungewöhnlich. Es war aber wohl die beste Lösung für ein kompliziertes Problem, das in der Mitte dieses Berichts auf knapp fünf Zeilen abgehandelt wurde.
Die Brookwetterung durchzog nicht nur Altengamme, Curslack und Bergedorf, sie war auf einem Teil der Strecke der Grenzgraben zwischen Hamburg und Preußen. Ihr Wasser kam vor allem von der Geest und den Moorwiesen. Durch den Horster Damm und den Brookdeich waren Altengamme und Curslack vor einem weiteren Vordringen des Wassers nach Süden geschützt (siehe die Karte der Vierlande).
Die Altengammer und Curslacker waren also vor allem an der Unterhaltung ihrer Deiche interessiert, der Zustand der Brookwetterung war vielen von ihnen ziemlich egal – dabei waren sie für die Unterhaltung und Reinigung des Wasserlaufs zuständig und verantwortlich. Wenn aber ein „Unterlieger“ seinen Abschnitt nicht instand hielt, hatten die „Oberlieger“ Abflussprobleme, auch wenn sie vorbildliche Arbeit geleistet hatten (bzw. hätten). Die Unterhaltungspflicht oblag den zahlreichen Eigentümern („Interessenten“) der angrenzenden Grundstücke, mal bis zur Mitte des Grabens, mal auf ganzer Breite, wobei die Breite wie auch die Tiefe im Laufe der Zeit deutlich abgenommen hatte, wie es im Antrag des Senats an das Landesparlament hieß (siehe Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft 1921, S. 604-608).
Es war aber nicht die schiere Großzügigkeit, die Hamburg zur Übernahme der Reinigung, Verbreiterung und Vertiefung veranlasste: sowohl auf preußischem als auch auf hamburgischem Gebiet sollte auf den bisherigen Moorwiesen intensivierte Landwirtschaft und Gartenbau betrieben werden, und das setzte niedrigere Wasserstände voraus. Und zumindest einen Teil der 100.000 Mark wollte sich der Staat von den „Interessenten“ durch eine jährliche Rente zurückholen, und dazu bedurfte es des Gesetzes.
Wer nun aber einen schnellen Beginn der Arbeiten erwartet hatte, sah sich ent- oder getäuscht. Auf den Hinweis eines Leserbriefschreibers, man möge doch jetzt, wo die Brookwetterung trockengefallen ist, das Erdreich herausschaufeln, antwortete die Landherrenschaft via BZ: Preußen sei noch nicht so weit; es müsse erst von den dortigen Unterhaltungspflichtigen eine Genossenschaft zur Erledigung der Arbeiten gegründet werden – sonst sei keine „dauernde Besserung der Verhältnisse“ zu erwarten (BZ vom 14. September 1921).
Hamburg war also schneller und großzügiger als Preußen, das offenbar keine Staatsbeihilfe zahlen wollte, aber zu schnell wollte man das bewilligte Geld nicht ausgeben.