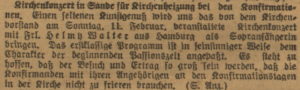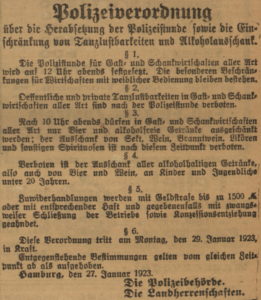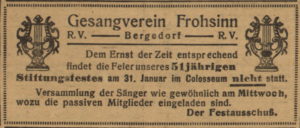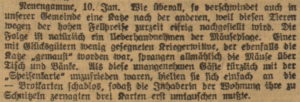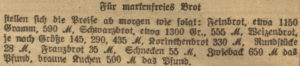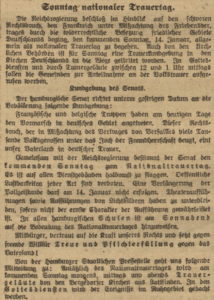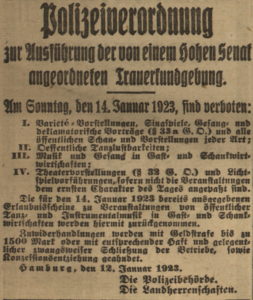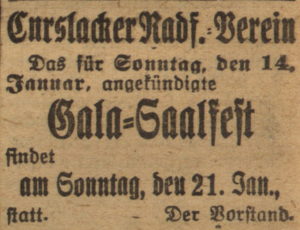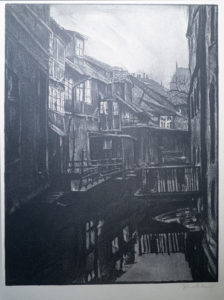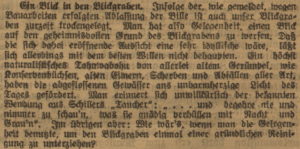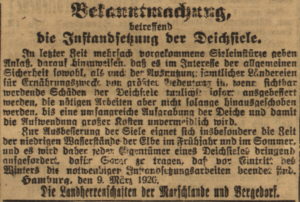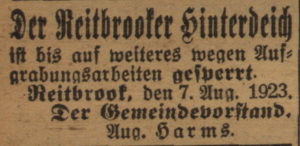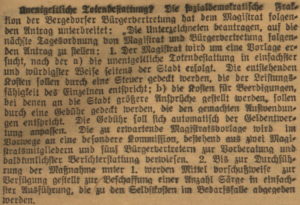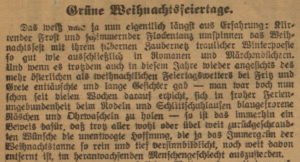Gestützt auf ärztliche Statistiken zeichnete der Bergedorfer Frauenverein ein dramatisches Bild des Gesundheitszustands der Kinder – und hatte auch gleich „unsere Feinde“ als die Schuldigen ausgemacht. Den Leserinnen und Lesern sollten Hungerblockade und Steckrübenwinter des Ersten Weltkriegs ins Gedächtnis gerufen werden, und so kurz nach der Besetzung des Ruhrgebiets durch Frankreich und Belgien öffneten Spendenappelle zugunsten deutscher Kinder sicher manche Geldbörse – man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die unbestreitbare Not der Kinder hier instrumentalisiert werden sollte.
Bescheiden zeigte sich die Kirchengemeinde in Sande: ihre Kasse war offenbar leer, denn die Einnahmen aus der Kirchensteuer sollten erst im Laufe des Jahres eintreffen (BZ vom 1. Februar), und so musste man sehen, wie man an Geld kam, um zu den Konfirmationsgottesdiensten die Kirche heizen zu können. Ein Wohltätigkeitskonzert sollte das Problem lösen: 100 Mark kostete laut Anzeige eine Karte, und es gab eine „vielköpfige Zuhörermenge“ (BZ vom 12. Februar) – ob das reichte, die große Kirche wirklich warm zu heizen, wurde nicht berichtet.
Es herrschte aber nicht überall Not: wenn Hamburger Feinkostläden „teuerste und edelste Delikatessen“ in ihre Schaufenster stellten, taten sie es, weil sie damit Kundschaft anlocken wollten, der der Preis ziemlich egal war. Ob die Aufforderung der Konsumentenkammer tatsächlich zu einem „scharfen Eingreifen der Behörden“ führte, stand nicht in der BZ. Ob andere getroffene Maßnahmen wie das Verbot „unnötiger kalter Büfetts“ (BZ vom 26. Januar) und der Herstellung von Schlagsahne, die das immer noch bestehende Hamburger Kriegsversorgungsamt anordnete (BZ vom 30. Januar), die weniger wohlhabende Bevölkerung beruhigten, kann bezweifelt werden.
Man kann aus der BZ nicht erschließen, in welchem Maß der Lebensmittel-Luxus auch in Bergedorf und Sande ein Problem war: im gesamten Monat Januar inserierten nur zwei Händler – das Angebot von Carl Gosch ging schon in Richtung Delikatesse, und auch die Würstchen konnte sich wohl nicht jeder leisten.