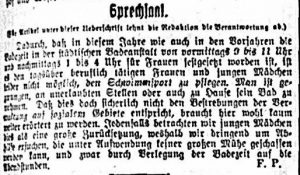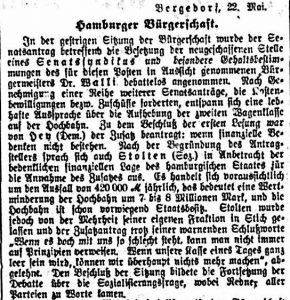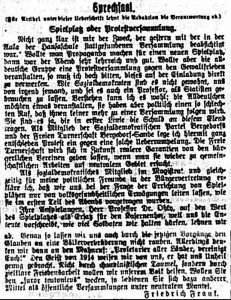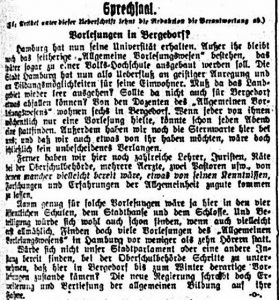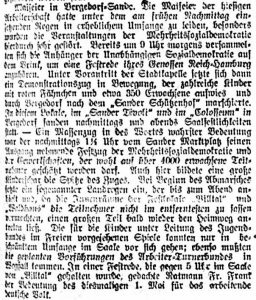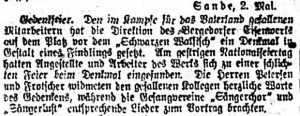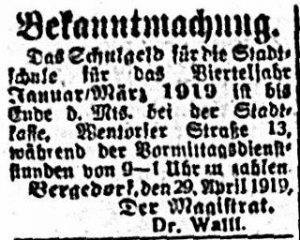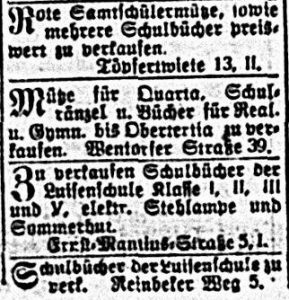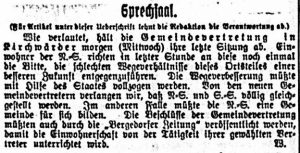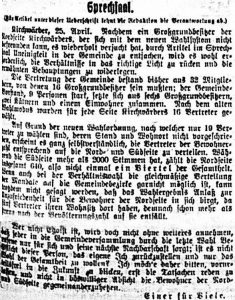In ihren politischen Rechten waren seit der Revolution die Frauen den Männern gleichgestellt – nicht aber im Recht auf Schwimmbadbenutzung, worüber sich die Leserbriefverfasserin „F.P.“ beschwerte. Dass den Männern mehr Zeit zur Verfügung stand und die im Beitrag Die Badesaison eröffnet geschilderte Ungleichbehandlung also die Revolution überdauert hatte, machte sie hier gar nicht zum Thema, sondern ihr ging es darum, dass die Verteilung der Stunden in der geschlechtergetrennten Badeanstalt geändert werden sollte: die Frauen-Zeiten lagen am Vormittag und frühen Nachmittag, sodass berufstätige Frauen sie praktisch (außer sonntags) nicht in Anspruch nehmen konnten, und sie versah ihre Forderung mit einer politischen Spitze: die Regelung stehe im Widerspruch zu „den Bestrebungen der Verwaltung auf sozialem Gebiete“, junge Mädchen sähen dies „als eine große Zurücksetzung“.
Mehrere Männer reagierten: ein W. Möller schlug vor, an zwei Wochentagen die Nachmittagsstunden zwischen Damen und Herren zu vertauschen und die Badezeit für die Männer dann abends zu verlängern (BZ vom 24. Mai), wogegen sich ein Herr Germer entschieden wandte, der „auch nicht zu Gunsten der Frauen“ auf Sonnenschein beim Baden verzichten wollte. Er machte gleich zwei Alternativvorschläge: entweder neben der vorhandenen Anlage ein reines Damenbad zu schaffen – oder wie in anderen Städten ein Familienbad zu errichten: „Für Prüderie ist in heutiger Zeit kein Platz mehr!“ Das könnte manche entrüstet haben.
Bergedorfs Verwaltung hielt sich offenbar bedeckt: in der BZ waren in diesem Jahr keine Meldungen über Änderungen von Zeiten oder gar Erweiterungsmaßnahmen zu finden. Das benachbarte Sande dagegen hatte bereits im Frühjahr mit dem Bau einer Gemeinde-Badeanstalt begonnen, auch, um damit die Arbeitslosigkeit zu verringern (BZ vom 10. Februar, 29. März und 10. April). Aber im Juni kam es zum Stillstand der Arbeiten: dem „Ausstich des Billufers“ musste der Staat Hamburg zustimmen, und das zog sich hin (BZ vom 17. und 23. Juni). Wie letztlich entschieden wurde, berichtete die BZ 1919 nicht – deshalb kann man davon ausgehen, dass die Badesaison in Sande ohne die neue Einrichtung verlief. Den Betreiber der privaten Sander Badeanstalt dürfte es gefreut haben.