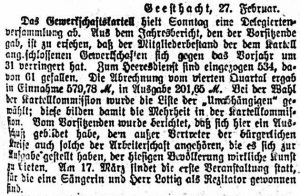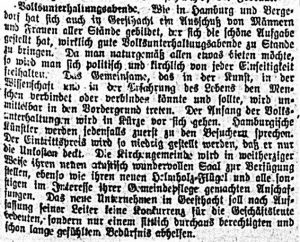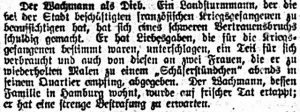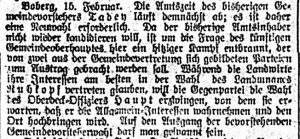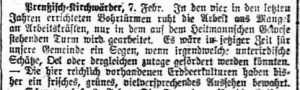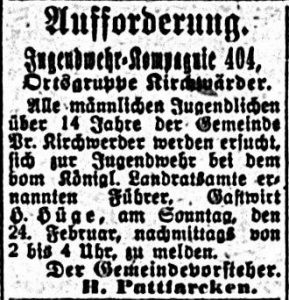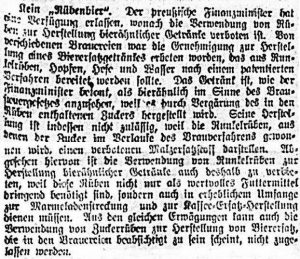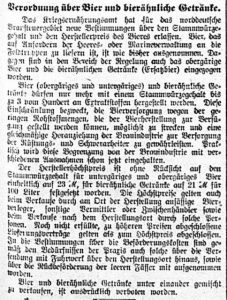Nicht die Gewerkschaften sollen im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen, sondern die „wirkliche Kunst“, die ein „Ausschuß“ nach Geesthacht bringen wollte, doch auch die Angaben zu den Gewerkschaften sind es wert, kurz beleuchtet zu werden:
534 Gewerkschaftsmitglieder aus Geesthacht hatten bis dato in den Krieg ziehen müssen, also etwa so viele wie die Ende 1916 verbliebenen 563 männlichen Mitglieder (BZ vom 21. März 1917). 61 hatten bis Ende 1917 durch den Krieg ihr Leben verloren. Die politischen Auseinandersetzungen in der Arbeiterbewegung, die im Beitrag Keine SPD-Spaltung in Bergedorf? thematisiert wurden, machten sich auch im Gewerkschaftskartell bemerkbar: bei den Wahlen zur Kartellkommission gab es offenbar Kampfwahlen mit einem Sieg der „Unabhängigen“, womit vermutlich die Anhänger der USPD gemeint waren.
Damit aber zu der „wirklichen Kunst“ und dem erwähnten Ausschuss: sein vollständiger Name war „Ausschuß für Volksunterhaltung“, der sich an dem Konzept der Volksheime orientierte, politisch neutral sein und unterschiedliche soziale Gruppen zusammenbringen wollte (BZ vom 4. Februar 1918). Seit kurzem gab es ja ein für Vorträge und Konzerte sehr gut geeignetes Gebäude: das im Herbst 1917 fertiggestellte Gemeindehaus der Kirchengemeinde St. Salvatoris mit Pastorat und einem großen Gemeindesaal (BZ vom 23. Oktober 1917). Diesen Saal und den neu angeschafften Konzertflügel stellte der Kirchenvorstand Veranstaltern für „jede … gediegene soziale Arbeit“ zur Verfügung (BZ vom 6. Februar 1918), aber natürlich gab es dort auch kirchliche Veranstaltungen (BZ vom 14. und 25. Februar sowie 5. März 1918).
Der Erste Volksunterhaltungsabend fand wohl wie angekündigt statt. Die Eintrittspreise waren sehr moderat. Leider gab es keinen Nachbericht der BZ, sodass über Programmdetails und Niveau (Stichwort „wirkliche Kunst“) nichts überliefert ist. Von den Künstlern ist hier nur der für die (Klavier-)Begleitung zuständige Herr Dürand bekannt, der als Leiter der Musikkapelle des Wachtkommandos im ersten Quartal 1918 außerdem mehrere Wohltätigkeitskonzerte veranstaltete (BZ vom 28. Januar, 12. und 20. März 1918).
Laut Artikel vom 19. Februar gab es einen solchen Ausschuss für Volksunterhaltung auch in Hamburg und Bergedorf – in Hamburg wird dies die „Kulturelle Vereinigung Volksheim e.V.“ gewesen sein, aber für Bergedorf sind vergleichbare Bestrebungen weder unter diesem noch unter einem anderen Namen aus der Zeitungsberichterstattung bekannt.