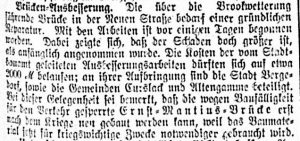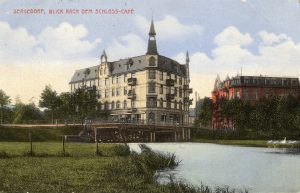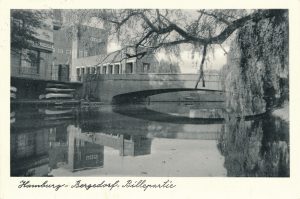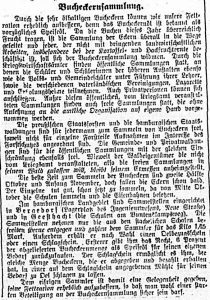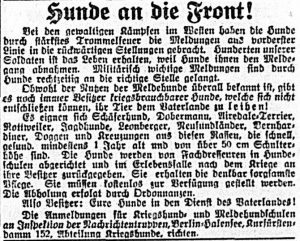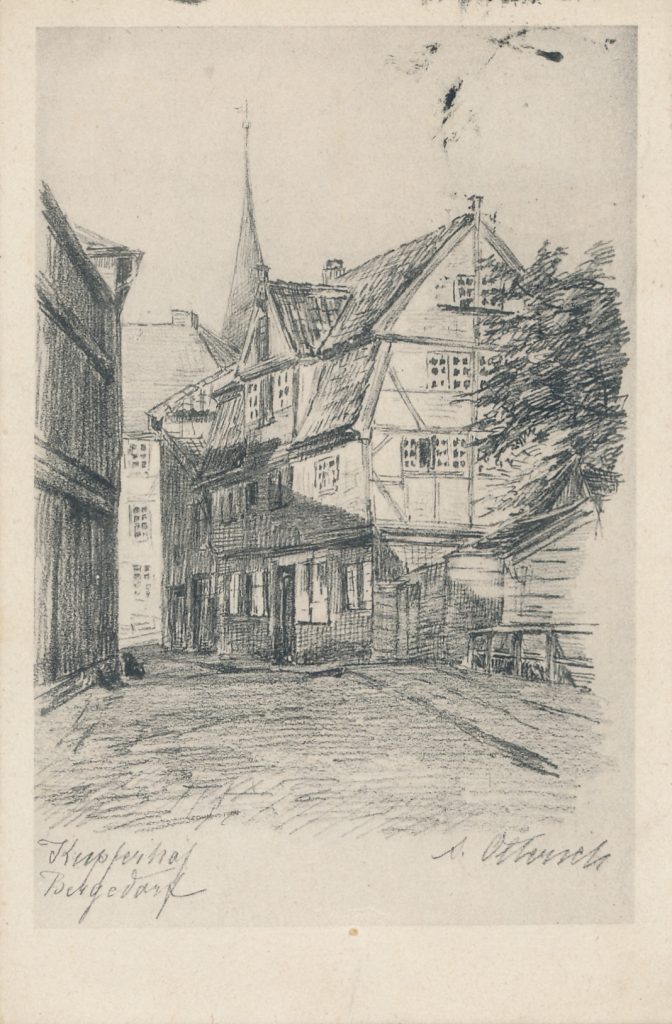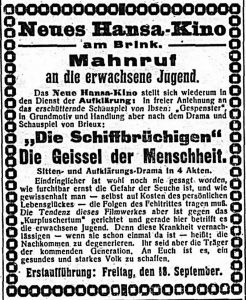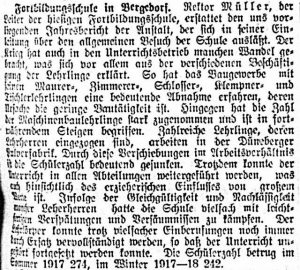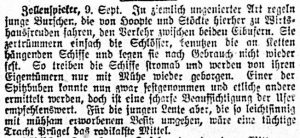Viel Aufhebens machte die Bergedorfer Zeitung wahrlich nicht von der Verleihung der Rote-Kreuz-Medaille (3. Klasse) an den Mittelschullehrer Hermann Berndt. Vermutlich war er, der hier die „Hilfe für deutsche Kriegsgefangene“ organisierte, der letzte Bergedorfer Empfänger dieser Auszeichnung: bald nach der Revolution verkündete die preußische Regierung, dass ab sofort keine Orden und Ehrenzeichen mehr vergeben würden (BZ vom 24. Dezember 1918). Das betraf auch die vom deutschen Kaiser und preußischen König gestiftete Rote-Kreuz-Medaille.
Nur wenige Bergedorfer hatten 1918 diese Medaille erhalten: der Führer der örtlichen Kolonne des Roten Kreuzes, A. Morgenbesser, die Leiterin der Luisenschule, Erna Martens, und der in Bergedorf wohnhafte Pastor Ditlevsen von der deutschen Seemannsmission, dazu aus Sande der dortige Zugführer der Kolonne des Roten Kreuzes sowie die Witwe des Amts- und Gemeindevorstehers Gustav Maik und die Kochschwester Marta Ohl (BZ vom 15. und 19. Februar, 20. März, 3. September und 2. Oktober).
Andere Orden wurden sehr viel häufiger vergeben: das Eiserne Kreuz (1. und 2. Klasse), das es nicht nur für Soldaten, sondern auch für Zivilisten gab. Das Ende 1916 gestiftete Verdienstkreuz für Kriegshilfe (BZ vom 7. Dezember 1916) erhielten 1917 alle Direktoren der Pulverfabrik Düneberg und der Dynamitwerke Krümmel sowie einige langjährige Arbeiter dort, insgesamt über dreißig Personen (BZ vom 1. Oktober 1917). 1918 gingen zwanzig Exemplare dieses Verdienstkreuzes allein in die Stadt Bergedorf, u.a. an den Schriftleiter Wilhelm Bauer der Bergedorfer Zeitung, den Bankdirektor Ludwig E. Bausewein und (natürlich) an Erna Martens, aber auch an weniger prominente Personen wie die Telegraphengehilfin Bertram oder den Gerichtsschreiber Hoppe. Weitere zehn gingen nach Sande, u.a. an sechs Werkmeister bzw. Arbeiter der Munitionsfabrik Weiffenbach in Sande (BZ vom 22. März, 13. Juni, 17. August, 6. und 27. September).
Warum wurde Berndt nicht schon früher für seinen unermüdlichen Einsatz geehrt? Vielleicht hatte er sich das falsche Tätigkeitsfeld gesucht: in den Augen der Regierenden war es verdienstvoller, für die Finanzierung des Kriegs, die Unterstützung der heldenhaften Kämpfer, zu werben als Geld zu sammeln für deutsche Kriegsgefangene, unter denen womöglich Feiglinge oder gar Deserteure waren (siehe hierzu den Aufsatz von Annette Becker im von Jochen Oltmer herausgegebenen Sammelband über Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkriegs).