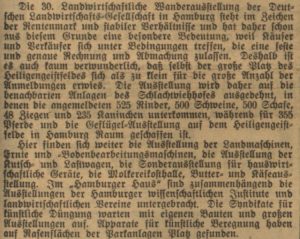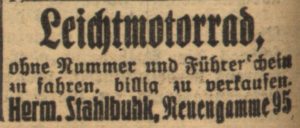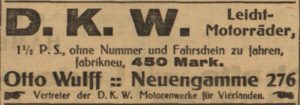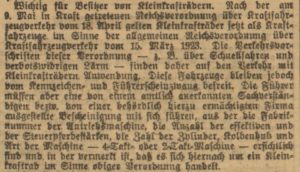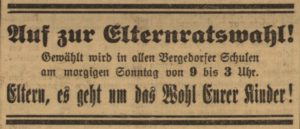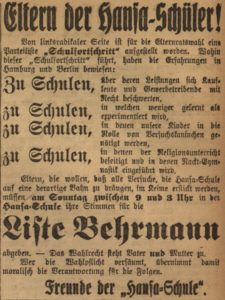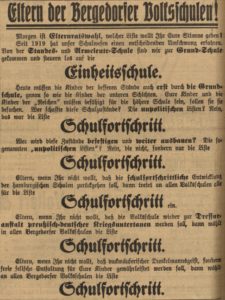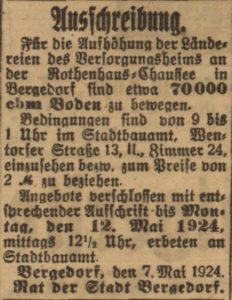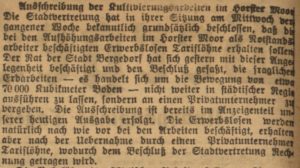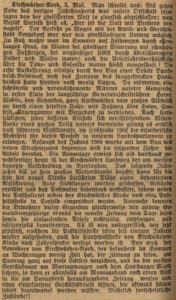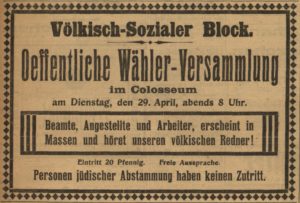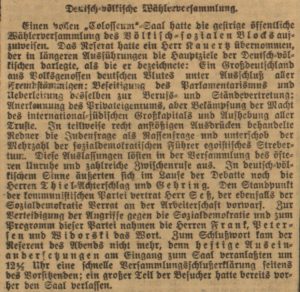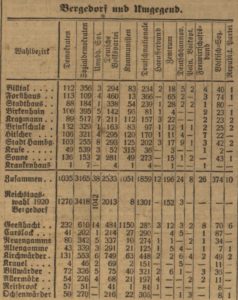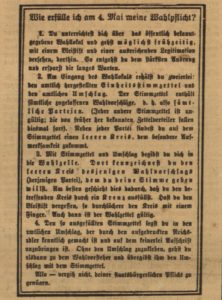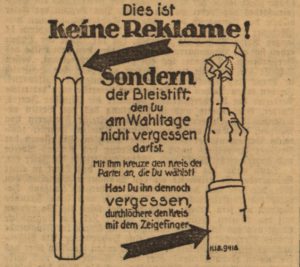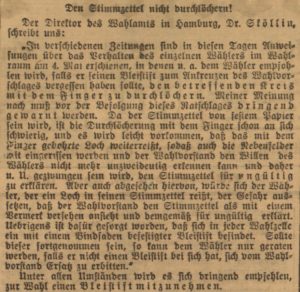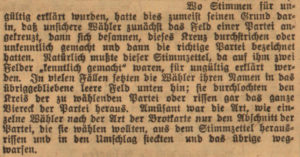Große Hoffnungen verband man in Hamburg mit dem Bau dieser Straße, die eine weitere Nord-Süd-Verbindung in Ochsenwärder schaffen sollte: an ihr sollten sich Gemüsebauern ansiedeln, die ihre Produkte dann per Marschbahn nach Hamburg schicken würden. Die Hoffnungen wurden größtenteils enttäuscht: noch heute gibt es kaum Anlieger an der 2.450 Meter langen Straße, in Teilbereichen immerhin Gartenbau. Der Bahnhof war zwar ab Mitte Juni 1924 gut erreichbar, aber der Bahnbetrieb war 1923 eingestellt worden (siehe den Beitrag zur Stilllegung). Als er im August 1924 wiederaufgenommen wurde (BZ vom 8. August 1924), gab es immer noch keine direkte Anbindung an Hamburg; alle Bahn-Beförderung von Personen und Gütern musste den Umweg über Bergedorf nehmen.
Die neue Straße hatte eine Pflasterung erhalten, aber die war nur drei Meter breit (BZ vom 27. Mai 1924). Wenn sich also zwei Fuhrwerke oder Lastkraftwagen begegneten, war ein Ausweichen auf den unbefestigten „Sommerweg“ neben der Fahrbahn unumgänglich, was bei aufgeweichtem Boden zu Problemen geführt haben dürfte. Die Baukosten waren übrigens von geplanten 980.000 Mark (im Sommer 1919, siehe Senatsantrag vom 22. August 1919, S. 521-525) über zusätzliche 127 Millionen Mark (BZ vom 12. März 1923) und weitere 68 Billionen Mark (BZ vom 18. Oktober 1923) gestiegen – die neuesten Nachforderungen waren da deutlich geringer, aber eben in Goldmark berechnet.
Als die neue Verbindung offiziell den Namen „Oortkatenweg“ erhielt (BZ vom 29. September 1924), war nicht jeder glücklich über die Schreibweise: vermutlich war es eine Zuschrift aus Ochsenwärder, die die BZ hier wiedergab, aber so eindeutig war und ist die Sache nicht, wie ein Blick ins Hamburgische Wörterbuch zeigt: das Doppel-O war durchaus gebräuchlich, und die Schreibweise mit Oo- ist auch heute u.a. in den Bezeichnungen von Bushaltestellen, Campingplätzen, Baggersee und des (wieder stillgelegten) Bahnhofs zu finden. Das Gasthaus „Zum Ortkathen“ fiel dem Hochwasserschutz zum Opfer (BZ vom 14. September 2015).