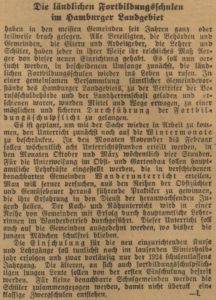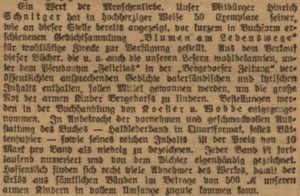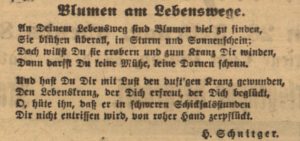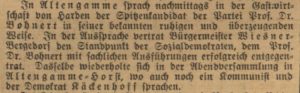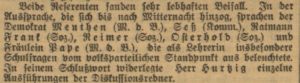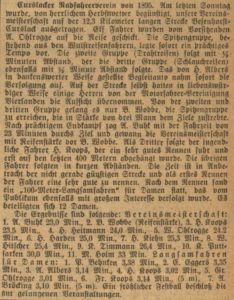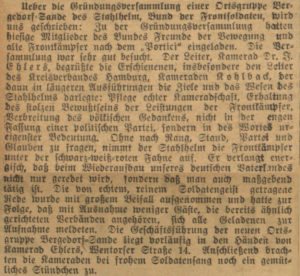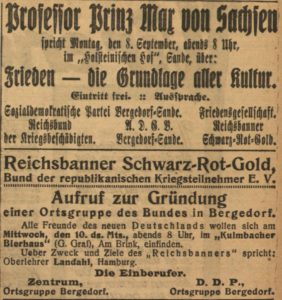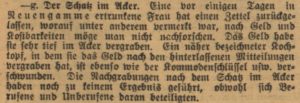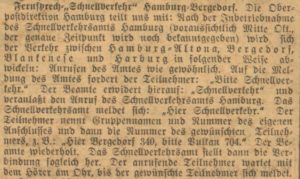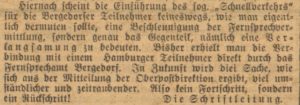Die 1919 eingeführte Fortbildungsschulpflicht stieß in den Dörfern um Bergedorf weiterhin auf verbreitete Ablehnung bis hin zum Boykott. Die Curslacker Gemeindevertretung zum Beispiel hielt „die Wiedereinführung des Fortbildungsschulunterrichts in der bisherigen Weise … für völlig zwecklos“ (BZ vom 30. September 1924): Verstöße gegen die Schulpflicht konnten nicht sanktioniert werden, und der Unterricht wurde von den Dorfschullehrern erteilt, nicht von Fachlehrern, brachte den Jugendlichen und den Betrieben also keinen fachlichen Nutzen.
Nun sollte ein neuer Versuch gestartet werden, mit reduzierter Stundentafel, zunächst beschränkt auf einen Schülerjahrgang, nur in den Wintermonaten, erteilt durch „führende Praktiker“ im Obst- und Gemüsebau, die als hauptamtliche Kräfte allerdings „Wanderunterricht“ geben sollten, also von Schule zu Schule wandern – mit einem solchen System habe man bei der weiblichen Jugend im Koch- und Nähunterricht gute Erfahrungen gemacht.
Die Einführung des neuen Modells in modifizierter Form ging in den Vierlanden schneller voran als in den Marschlanden, und statt zahlreicher „einklassiger und einstufiger Zwergschulen“ sollte es wenige größere Fachschulen geben, auch für den Hauswirtschafts- und Kochunterricht der Mädchen (BZ vom 19. September und 7. Dezember 1925).
Im städtischen Bereich war die Lage etwas anders: dort forderte die Wirtschaftliche Vereinigung, also der örtliche Arbeitgeberverband, den Fortbildungsunterricht außerhalb der Arbeitszeit zu ermöglichen (BZ vom 26. Juni 1924), also abends und/oder sonntags. Dazu kam es aber nicht.