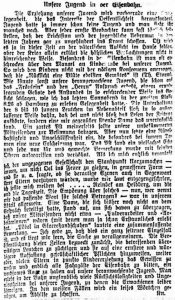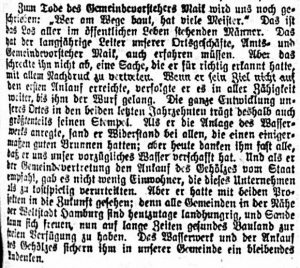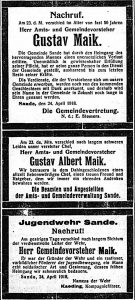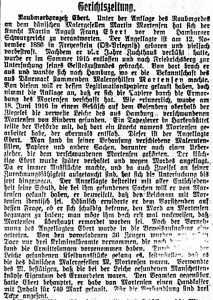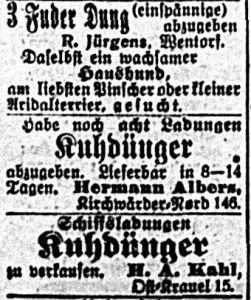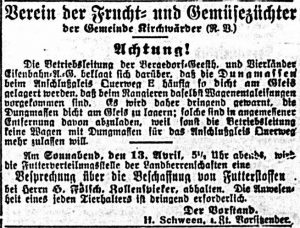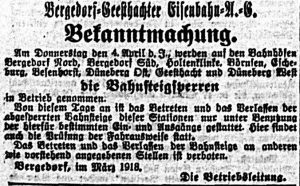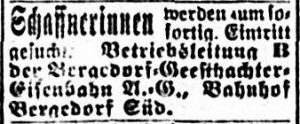Was diese ungenannte Inserentin bzw. diesen ungenannten Inserenten dazu brachte, eine „Heinzelmännchen“-Kochkiste zu verkaufen, weiß man nicht – aber Abnehmer werden sich schnell gefunden haben, wenn der Preis stimmte.
Hauptzweck einer Kochkiste war die Einsparung von Energie beim Kochen: nicht nur Kohle war rationiert (siehe den Beitrag Keine Kohle, kein Gas, aber große Kälte), seit August 1917 musste auch der Kochgas-Verbrauch auf 90 Prozent des Vorjahreswerts gesenkt werden, wenn man Strafzahlungen (50 Pfennig pro Kubikmeter) vermeiden wollte – es drohte sogar die Absperrung des Anschlusses. Bei dieser (zunächst als geringfügig erscheinenden) Einsparverpflichtung, die immer auf den Vorjahresmonat berechnet wurde, muss man berücksichtigen, dass es 1917 tagelang gar kein Gas gegeben hatte und dann nur stundenweise Lieferung (BZ vom 13. und 14. August 1917). Da war jede Möglichkeit der Verbrauchsreduzierung willkommen, zumal die Gaspreise zum 1. Mai 1918 wieder gestiegen waren (auf 24 Pfennig pro Kubikmeter in Bergedorf, in Geesthacht ab Juli auf 21 Pfennig für Kochgas und 25 Pfennig für Leuchtgas, BZ vom 20. April und 4. Juli 1918).
Das Funktionsprinzip einer Kochkiste wird auf einer Seite des Heimatvereins Teltow sehr anschaulich erklärt; man findet dort auch Abbildungen einer Heinzelmännchen-Kochkiste, von der es sogar eine Spielzeugversion gab. Ein ähnliches Produkt war die „Moha-Kochkiste“ (Link zu einer Abbildung), die Johannes M. Chr. Schütt in Bergedorf neben dem „Heinzelmännchen“ anbot (BZ vom 30. Juli 1918). Die Schlichtversion war die selbstgebaute Kochkiste, die die Zeitung schon 1914 empfohlen hatte.
Auch heute findet man im Internet Bauanleitungen für Kochkisten, die als Isoliermaterial statt Heu meist Styropor o.ä. empfehlen. Noch einfacheres Nach- bzw. Fertiggaren und Warmhalten ist unter einer Bettdecke möglich.