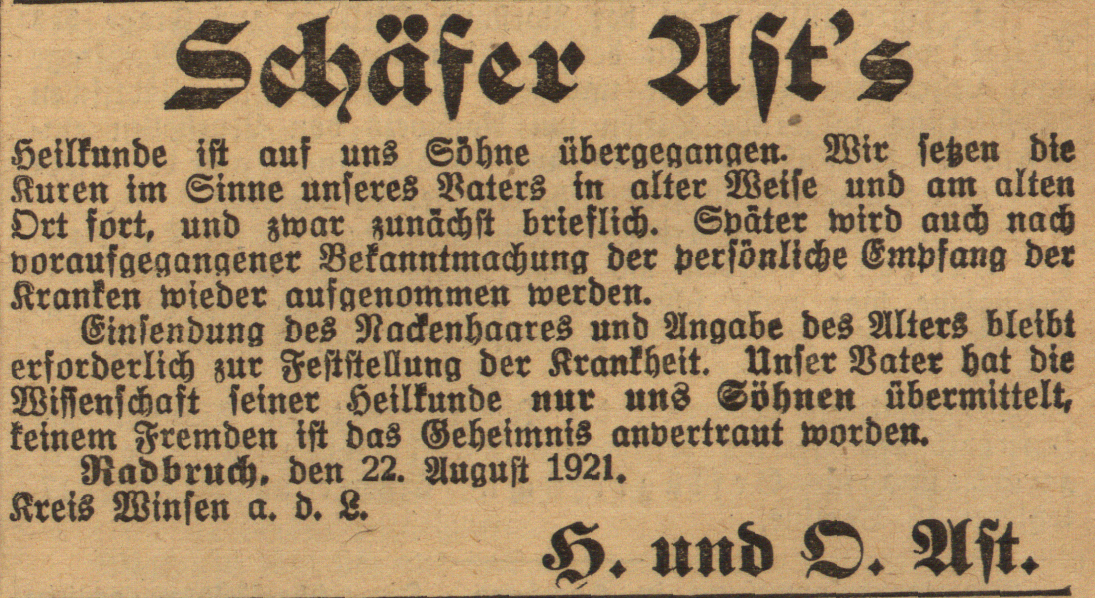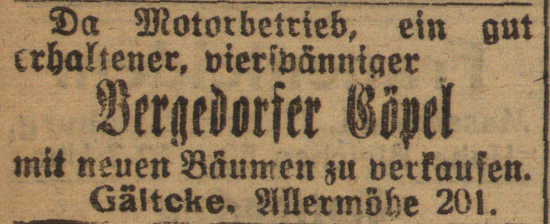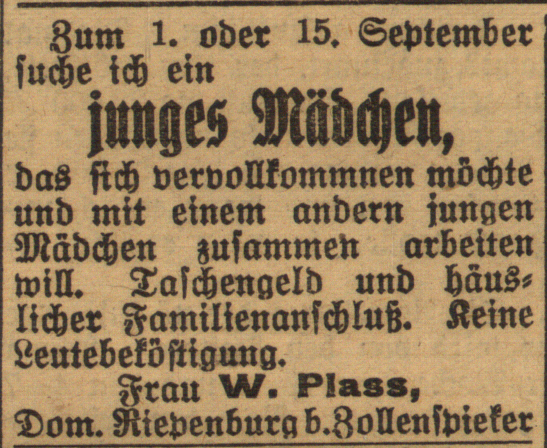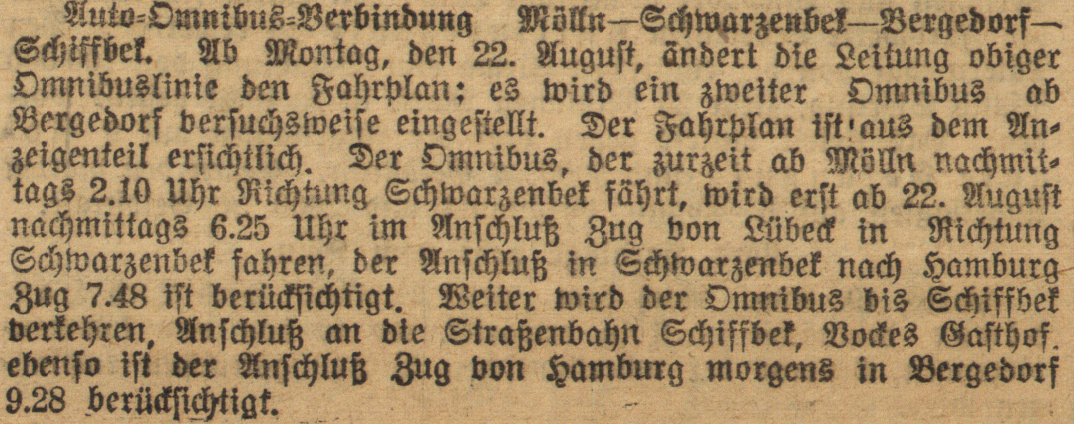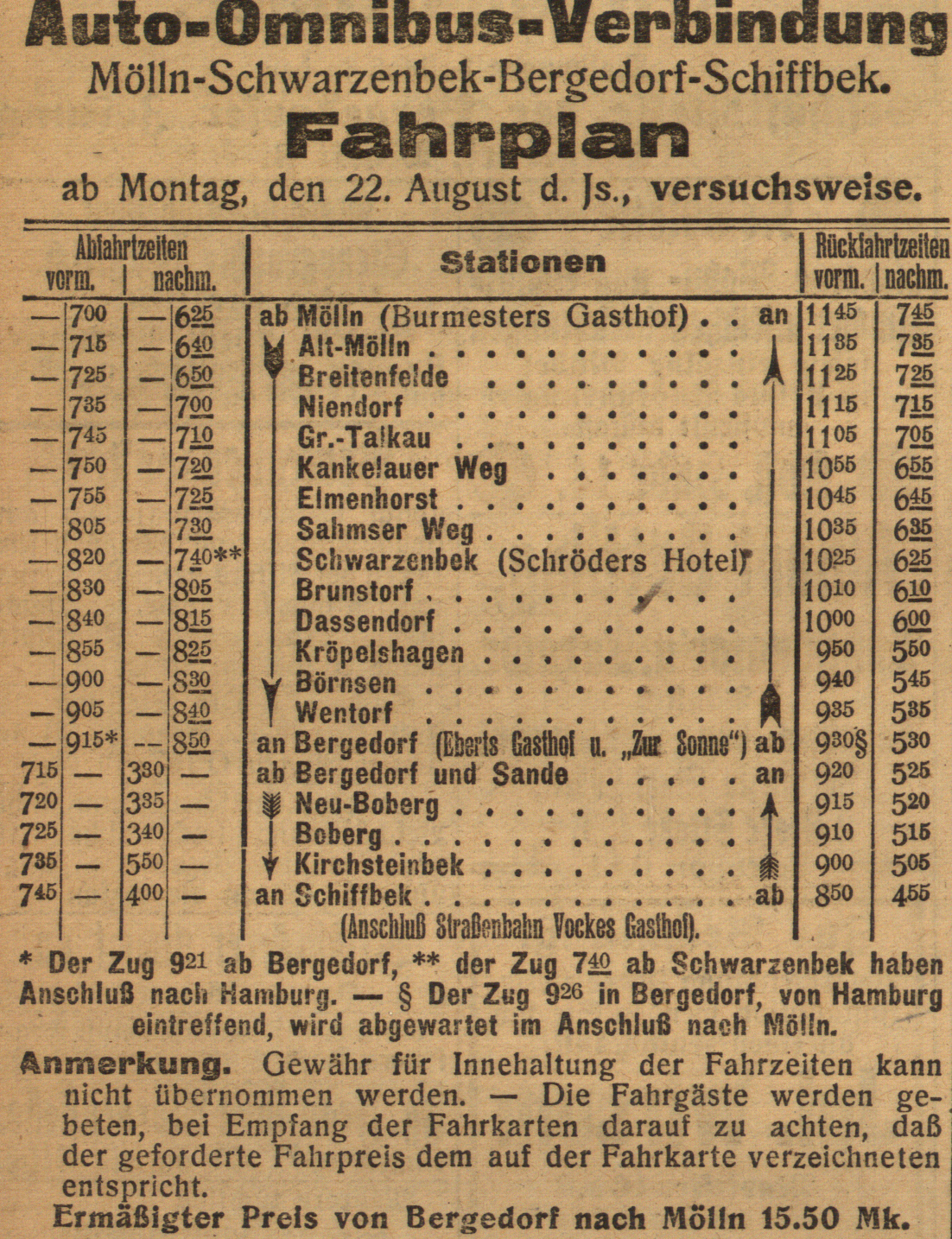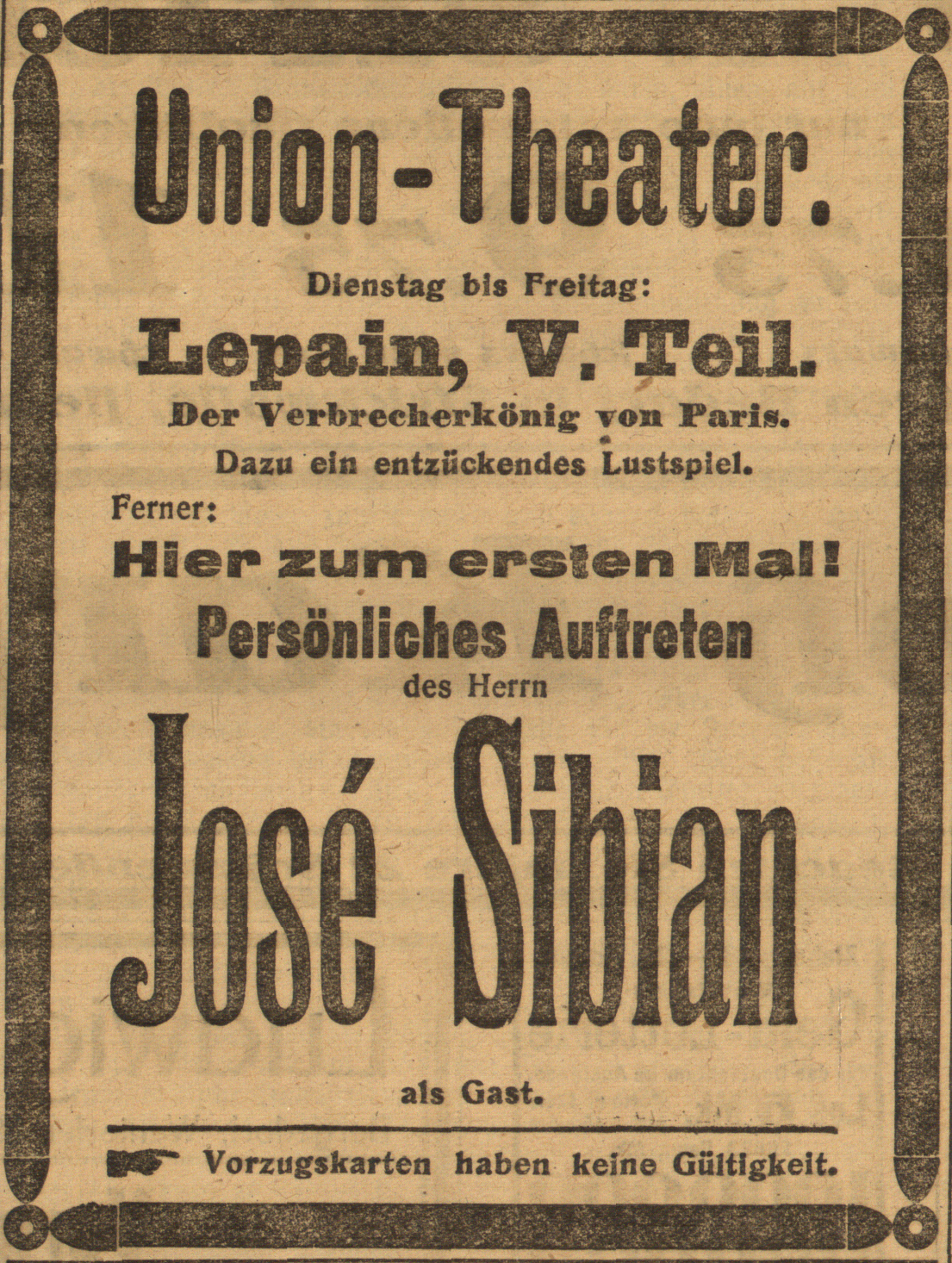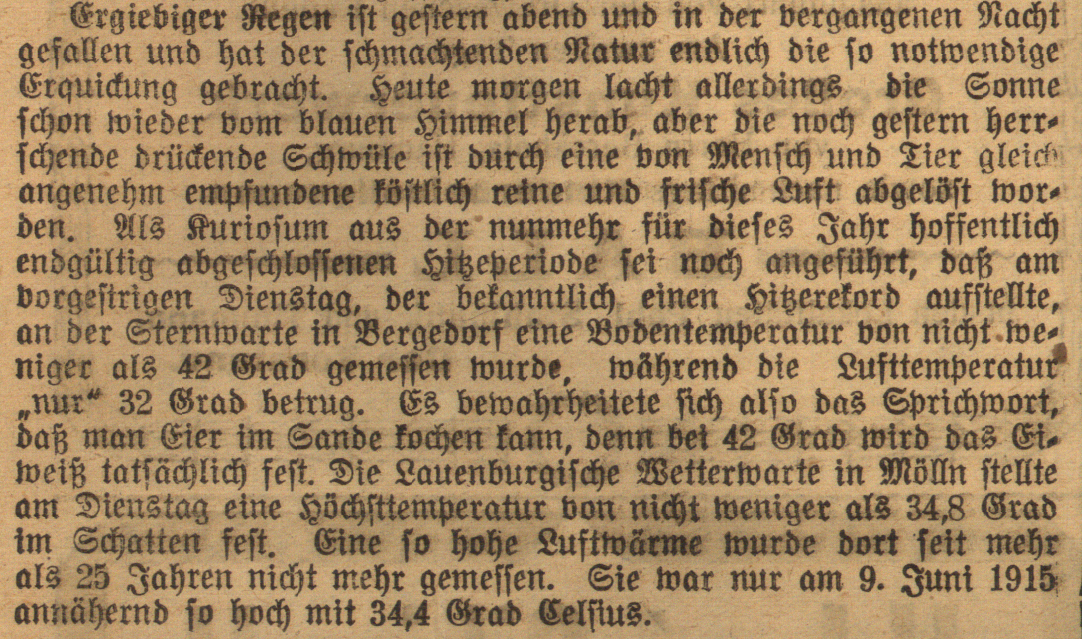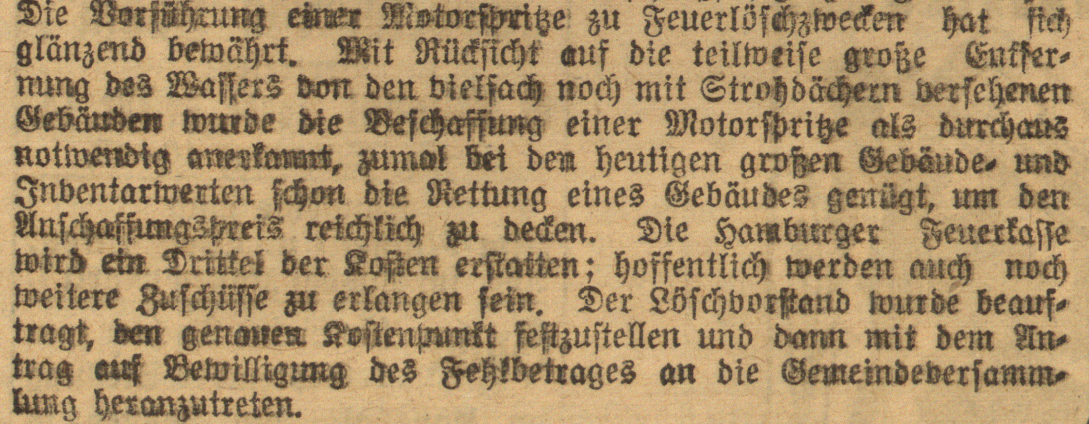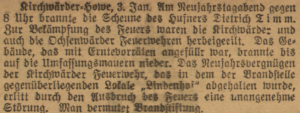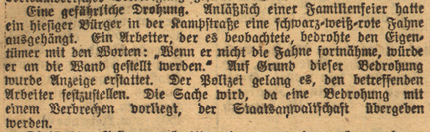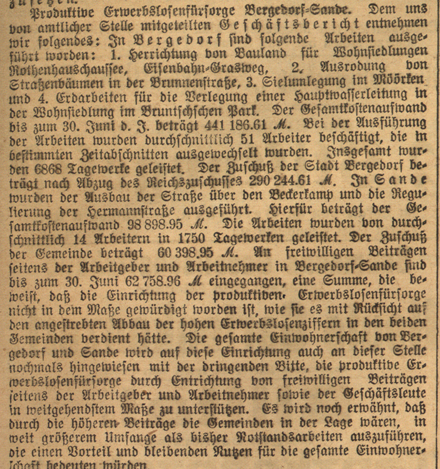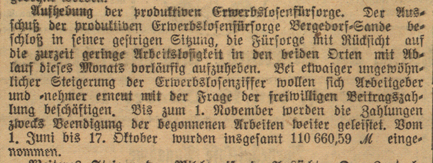Die Bergedorfer Zeitung glaubte nicht an Wunderheiler, sonst hätte sie wohl nicht in einem so mokanten Ton über den neuen Wunderdoktor vom Neuengammer Hinterdeich berichtet, der per Anzeige seine Dienste anbot.
Ohdes Rat folgte der Methode des kürzlich verstorbenen „Schäfer Ast“, der auf der anderen Elbseite (in Radbruch bei Winsen an der Luhe) lange Jahre erfolgreich gewirkt hatte – jedenfalls wirtschaftlich erfolgreich, und Ohde hoffte als Epigone sicher auf ähnlichen Wohlstand.
Philipp Heinrich Ast hatte die „Nackenhaardiagnose“ praktiziert: ihm hatte die Betrachtung abgeschnittener Nackenhaare unter der Lupe genügt, um Krankheiten zu identifizieren, und er hatte einen Katalog von Tropfen, Salben etc., die Heilung herbeiführen sollten, wie auf chronik-ramelsloh.de nachzulesen ist. (Die BZ-Beschreibung des „herrschaftlichen Hauses“ Asts dürfte eher auf die Winsener Apotheke zutreffen, in der Asts Mischungen hergestellt und verkauft wurden – und nach wie vor werden. Das Wohnhaus Asts war ländlicher Art, wie verschiedene Abbildungen zeigen.)
Als der Neuengammer Gemüsebauer eine Woche später seine Annonce erneut erscheinen ließ, wurde sie von einer größeren begleitet, in der zwei Söhne Asts sich als die einzigen legitimen Erben der Heilkunst des Schäfers von Radbruch deklarierten: „keinem Fremden ist das Geheimnis anvertraut worden“, nur sie hätten es. Wie sich das auf die Geschäfte Ohdes auswirkte, ist unbekannt. Er war jedenfalls nicht der einzige, der mit der „Methode Ast“ Geld verdienen wollte: Ernst Julius Buchholz praktizierte einige Jahre später in Hamburg, wo er 1927 wegen (nackenhaarsträubenden) Betrugs zu einer Geldstrafe von 30.000 Mark verurteilt wurde, wie es im Blog von Uwe Ruprecht heißt.
Hinweis: Von August bis Oktober 2021 soll im Winsener Museum im Marstall eine Sonderausstellung stattfinden: „Wunderheilung im Akkord“.