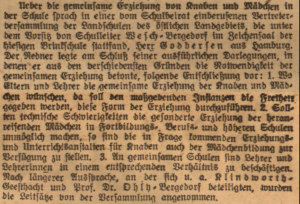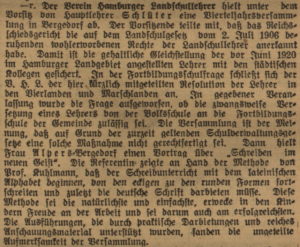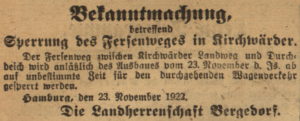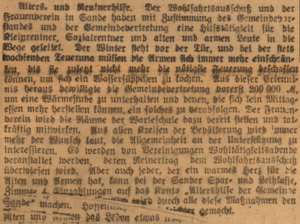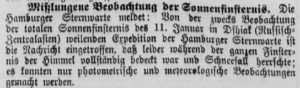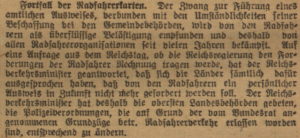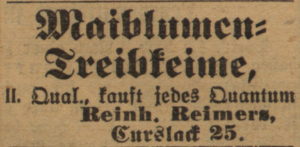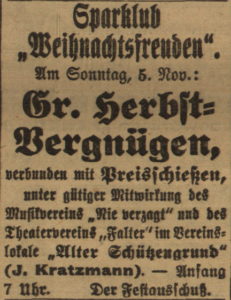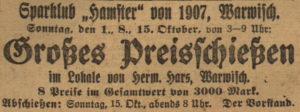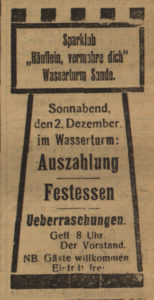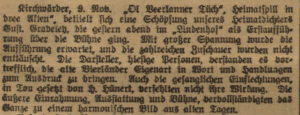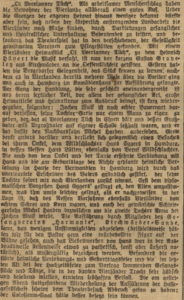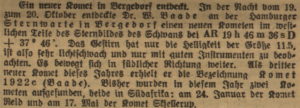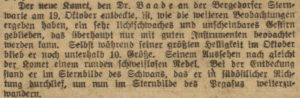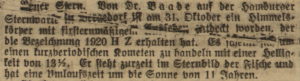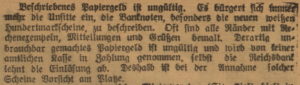„Gemeinsame Erziehung von Knaben und Mädchen in der Schule“ gab es schon lange in der Landherrenschaft Bergedorf, aber nur gezwungenermaßen: in manchen der kleinen Dorfschulen reichte die Schülerzahl nicht für die ansonsten übliche Trennung nach Geschlechtern (siehe hierzu die Geschichte des hamburgischen Landschulwesens (S. 174)). In Bergedorf war es 1856 sogar als Fortschritt empfunden worden, dass mit dem Bezug der neuerbauten Stadtschule am Brink endlich Mädchen und Knaben getrennt unterrichtet werden konnten (ebd., S. 207-233), 1922 verteilt auf zwei und zwei Schulen.
Zur Regel wollten die Repräsentanten der Bergedorfer Schulen die Koedukation allerdings nicht machen. Nur wenn Eltern und Lehrer dies wünschten, sollte entsprechend genehmigt werden. Immerhin, so der zweite Punkt der Entschließung, sollte die Bildung von Mädchen nicht daran scheitern, dass „Fortbildungs-, Berufs- und höhere Schulen“ nur Knaben offenstanden – das war für die Hansaschule nicht neu: dort waren 1920 einige Mädchen in die Oberstufe aufgenommen worden, weil sie sonst keine Möglichkeit gehabt hätten, in Bergedorf das Abitur zu erreichen (siehe den Beitrag zu Mädchen an der Hansaschule).
Bis zur vollen Koedukation an den staatlichen Schulen sollte es noch lange dauern; sie blieb auf Versuchsschulen wie z.B. die Hamburger Lichtwarkschule beschränkt. Dort hatte die Koedukation sogar ehestiftende Wirkung unter den Klassenkameraden Helmut Schmidt und Hannelore (Loki) Glaser.
Ein weiteres Reformvorhaben betraf die Schrift, die in der Schule gelehrt werden sollte: Käthe Alpers, laut Hamburgischem Lehrerverzeichnis 1922/23 (S. 180) Lehrerin an der Mädchenschule Birkenhain, referierte vor ihren Kolleginnen und Kollegen im Verein der Landschullehrer, wobei sie sich auf Fritz Kuhlmanns Schrift „Schreiben in neuem Geiste“ bezog: der Schulunterricht müsse mit der lateinischen Schrift beginnen und erst zuletzt die deutsche Schrift lehren, die bis dahin Standard war. Wenn der Berichterstatter schrieb, dass Frau Alpers‘ Ausführungen „die ungeteilte Aufmerksamkeit der Versammlung“ fanden, so kann man dies durchaus als höfliche Umschreibung einer Zurückweisung interpretieren.
Es dauerte noch fast zwanzig Jahre bis zur Streichung der deutschen Schrift aus dem Lehrplan (siehe den Artikel Ausgangsschrift auf Wikipedia). Kuhlmanns Konzept einer Grundschrift, aus der eine individuelle Schreibschrift sich entwickeln sollte, ist im 21. Jahrhundert als Schulversuch im Einsatz.
Überstürzt wurden die Reformen also nicht eingeführt.