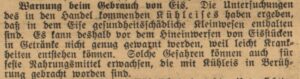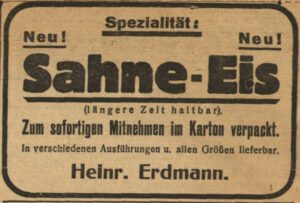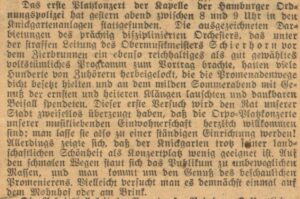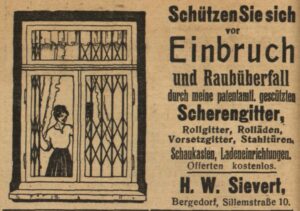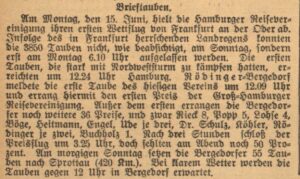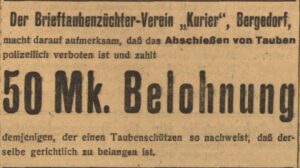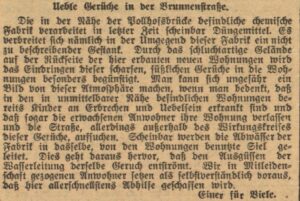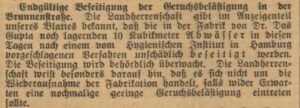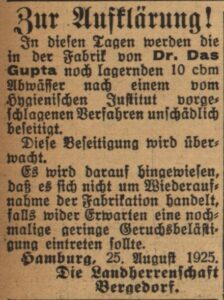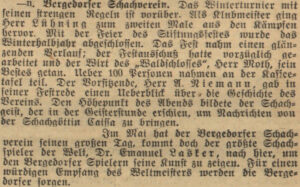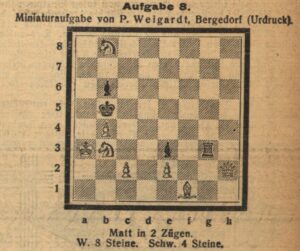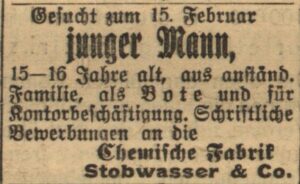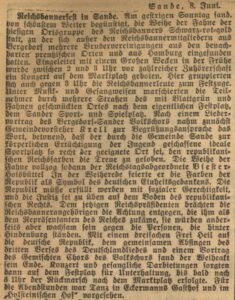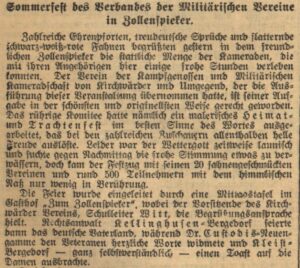1925 gelangte eine für Bergedorf neue Form der Außenwerbung in die Stadt: die Anschlagsäule, nach ihrem Erfinder Ernst Litfaß (1816-1874) auch Litfaßsäule genannt. Ob in Bergedorf hierfür ein genuiner Bedarf bestand oder ob dieser erst durch Werbung per Zeitungsanzeige geweckt werden musste, sei dahingestellt, aber in den ersten Wochen ihrer Präsenz waren die vierzehn Säulen, die die Stadtvertretung im Frühjahr genehmigt hatte, unbeklebt. Das war sicher kein schöner Anblick, wobei sich die BZ vor allem an dem Werbeträger auf dem Marktplatz, also vor ihrem Gebäude, störte (BZ vom 23. Mai).
Am sogenannten „wilden Plakatieren“ dürften die kostenpflichtigen runden Werbeträger nichts geändert haben, denn es kostete ja nichts, Werbung auf einer Mauer, Holzwand o.ä. anzubringen, wovon vor allem in Wahlkämpfen für politische Botschaften Gebrauch gemacht wurde. Nach dem Wahltag blieben die Blätter bzw. ihre nicht abgerissenen Reste kleben, sodass die Hamburger Baupflegekommission an die Hausbesitzer appellierte, diese das Stadtbild beeinträchtigenden Plakate zu entfernen (BZ vom 9. Januar). In der Stadt Hamburg wurde wildes Plakatieren sogar unter Strafe gestellt, doch der Appell der BZ, die Landherrenschaft solle dies auch für die Stadt Bergedorf verfügen (BZ vom 18. März) verhallte offenbar ungehört.