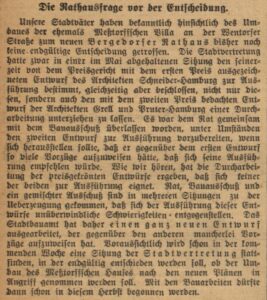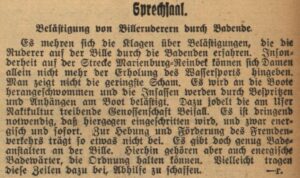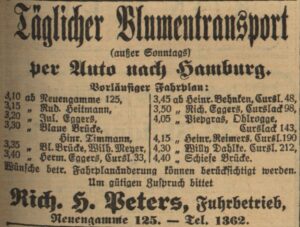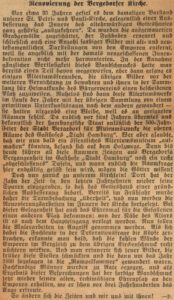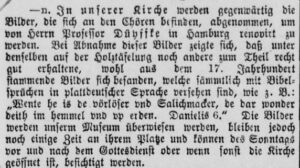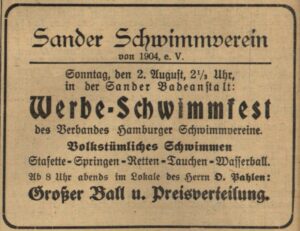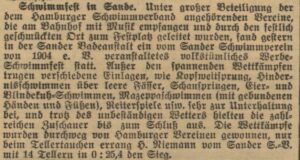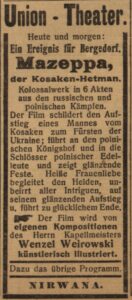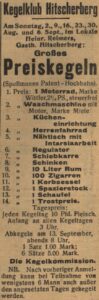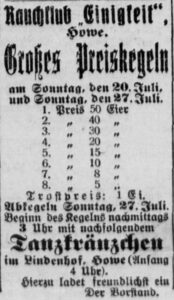Nicht nur der Sieger des Wettbewerbs wurde disqualifiziert, sondern auch der Zweitplatzierte. Zum Sieger ernannt wurde ein Nicht-Teilnehmer, was aber erstaunlicherweise keine öffentliche Empörung auslöste.
Es ging immerhin um den Wettbewerb für den Bau des Bergedorfer Rathauses: die Durcharbeitung der zwei Siegerentwürfe durch das Bergedorfer Bauamt hatte ergeben, „daß sich keiner der beiden zur Ausführung eignet.“ Nun sollte ein neuer Entwurf zum Zuge kommen, erstellt vom Leiter des Bergedorfer Stadtbauamts, Wilhelm Krüger – hörte da niemand eine Nachtigall trapsen?
Welche Maßstäbe genau angelegt wurden, ist unklar, wie auch Olaf Matthes und Otto Steigleder (S. 23ff.) schreiben, und da die Entwürfe Schneider sowie Grell und Pruter offenbar nicht archiviert wurden, ist eine nachträgliche vergleichende Bewertung schlicht unmöglich – die Pläne der eigentlichen Sieger wurden wohl im wahrsten Sinne des Wortes verworfen.
Krüger schrieb später (in: Das neue Bergedorf 1931, S. 21), dass der Wettbewerb ergeben habe, „daß mit geringen Mitteln keine befriedigende Lösung erzielt werden konnte.“ Sieger Schneider hatte mit 240.000 Mark gerechnet, der zweite Sieger Grell und Pruter mit 260.000 Mark – da wundert es schon, dass Magistrat und Stadtvertretung beschlossen, den Entwurf Stadtbauamt-Krüger zu realisieren, für den Ausgaben von 400.000 Mark bewilligt wurden, obwohl lediglich 300.000 Mark sicher verfügbar waren (BZ vom 14., 15. und 19. August 1925), aber man hoffte ja auf Steuermehreinnahmen.
Bei der endgültigen Beschlussfassung in der Stadtvertretung herrschte weitgehend Einigkeit; am Ende lehnten nur die KPD-Vertreter ab, die lieber Wohnungs- statt Rathausbau gesehen hätten. Alle anderen Abgeordneten stimmten den Plänen zu, obwohl es in Einzelpunkten durchaus unterschiedliche Auffassungen gab: während Bürgervertreter Leonhardt den Erhalt „aller alten Räume“ forderte, hielt Bürgervertreter Rümcker „das Messtorffsche Gebäude mehr oder weniger für Kitsch“ (BZ vom 19. August 1925).