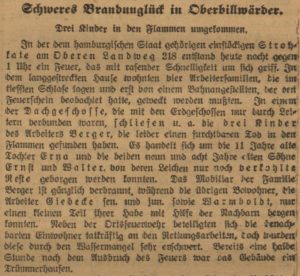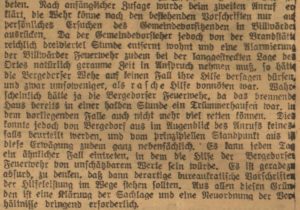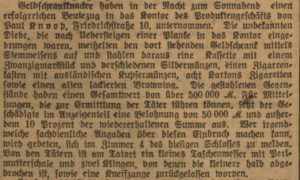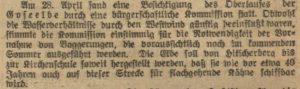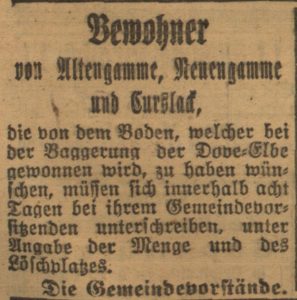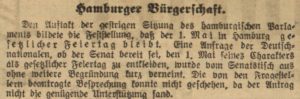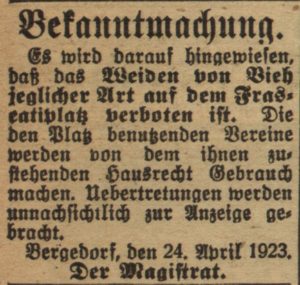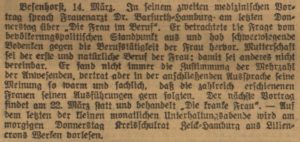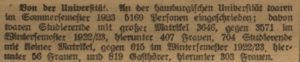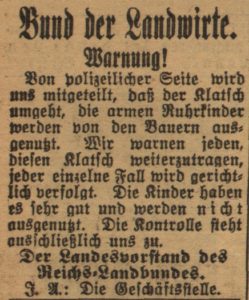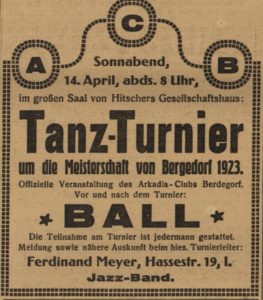Es war ein furchtbares Unglück: drei Kinder verloren ihr Leben, als ein Haus in Billwärder niederbrannte. Die Bauart des Hauses und die Wohnverhältnisse dürften das Feuer gefördert haben.
Die vier Wohnungen des Hauses müssen winzig gewesen sein, sonst hätten die Kinder nicht direkt unter dem Strohdach des einstöckigen Hauses geschlafen, und vermutlich waren die Dachbereiche nur durch Bretterwände voneinander getrennt – ein Feuer musste fatale Folgen haben, so wie hier, zumal die Brandbekämpfung nicht sofort einsetzen konnte: das Spritzenhaus der Freiwilligen Feuerwehr Billwärder lag mehrere Kilometer entfernt und das Löschgerät wurde von Pferden gezogen, die erst herangeführt und eingespannt werden mussten.
Die Feuerwehr aus Bergedorf, die telefonisch alarmiert worden war, stand vor den gleichen Problemen, und sie verhielt sich vorschriftsgemäß: sie hätte vom Billwärder Gemeindevorsitzenden offiziell angefordert werden müssen, und da das nicht geschah, beschränkte sie sich auf die Brandbeobachtung aus der Ferne, und außerdem sei ja sowieso nichts mehr zu retten gewesen. Das wiederum empörte die BZ: derartige bureaukratische Vorschriften sollten der Hilfeleistung nicht im Wege stehen, und sie warnte vor Wiederholungsfällen.
Nicht zu klären war anhand der vorliegenden Berichterstattung, ob die „bestehenden Vorschriften“ der Bergedorfer Feuerwehr jegliche Grenzüberschreitung zu Einsatzzwecken untersagten – oder ob es nur um die Kostenübernahme für den Einsatz ging.
Immerhin: ein halbes Jahr später wurden die Vorschriften geändert: die Bergedorfer durften fortan „auf Anruf hin sofort ausrücken“, und für den Einsatz musste die Gemeinde Billwärder finanziell geradestehen.
Das abgebrannte Haus vom Bautyp „Langer Jammer“ (siehe hierzu eine Seite des Denkmalvereins) hatte der Stadt Hamburg gehört, und sie wollte nun einen Neubau für die Brandgeschädigten errichten: zweigeschossig, vier Wohnungen mit je zwei Zimmern, Flur und Wohnküche. Die Baukosten wurden im August mit 400 Millionen Mark veranschlagt – sieben Wochen später benötigte man eine Billion und 623,75 Milliarden Mark. Hyperinflation eben.