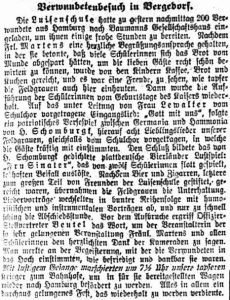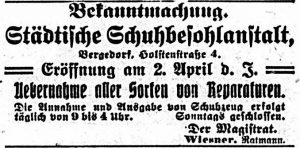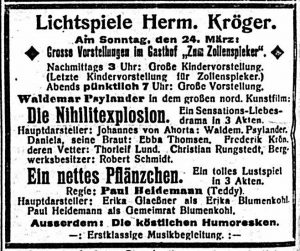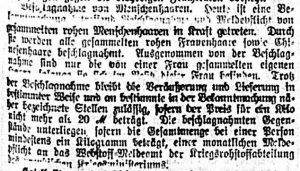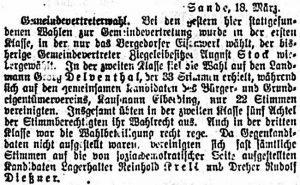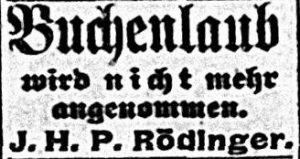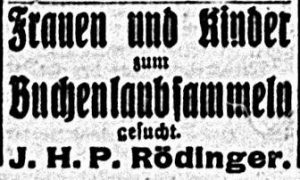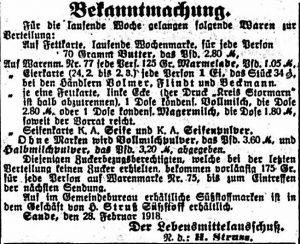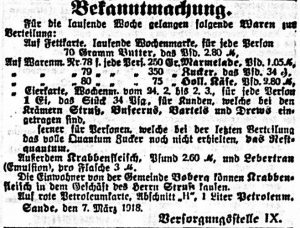Den Sudan kennt man heute als einen Staat in Nordost-Afrika, der in der Zeit des Ersten Weltkriegs nach den dort herrschenden Kolonialmächten als „anglo-ägyptischer Sudan“ bezeichnet wurde. „Sudan“ bezeichnet aber auch eine Großlandschaft, die Afrika südlich der Sahara in west-östlicher Richtung durchzieht. In Westafrika gab es den „französischen Sudan“ und auch den „deutschen Sudan“ – besser bekannt unter dem Namen Togo als damalige deutsche Kolonie.
Aber wie kam ein Bergedorfer aus angesehener Familie (dazu unten mehr) dazu, in Afrika einen Film zu drehen (Link zu einer Inhaltsangabe)? Diese Frage beantwortet Olaf Matthes in einem kurzen Aufsatz, der auch eine diesen Hans (Hermann) Schomburgk betreffende Korrespondenz des Auswärtigen Amts im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz von 1912 ausgewertet hat: danach wurde der Siebzehnjährige als „Thunichtgut“ über See geschickt und führte (unterbrochen durch seinen einjährigen Militärdienst in Deutschland) in Afrika ein abwechslungsreiches Leben als englischer Polizeioffizier, Großwildjäger und Forschungsreisender. Als Tierfänger brachte er im Auftrag Carl Hagenbecks das erste westafrikanische Zwergflusspferd nach Hamburg, als liberianischer Major wurde er Militärattaché in London, um dann als Vortragsreisender und Buchautor (auch) in Deutschland zu reüssieren: „Seine spannend und zum Teil dramatisch erzählten Afrika-Expeditionsberichte brachten ihm ein Millionenpublikum ein.“ (Matthes, ebd., S. 13. Lesenswert auch der ebenfalls von Matthes stammende Eintrag zu Schomburgk in der Hamburgischen Biographie (Bd. 5, S. 329f.).)
Sein Vater Hermann Schomburgk (siehe Bergedorfer Personenlexikon) war ein bekannter Architekt, der nicht nur Häuser im Villenviertel entwarf, sondern z.B. auch den Bismarckturm in Aumühle sowie die Bahnhöfe Bergedorf-Süd und Kirchwärder-Nord (Bilder in Rolf Wobbe, Chronik der Vierländer Eisenbahn). Er betätigte sich wie sein Sohn auch schriftstellerisch, verfasste z.B. ein Gedicht zur Einweihung der Vierländer Bahn (nachzulesen bei Rolf Wobbe, ebd.) und schrieb mehrfach Theaterstücke für die Luisenschule: 1917 gelangte sein „Held Fritz und Lieschen Bangebüx“ zur Aufführung (BZ vom 23. Januar 1917), 1918 sein plattdeutsches Vierländer Lustspiel „Fru Sinater“ sowie das „patriotische Versespiel zwischen Germania und Hammonia“, das Schülerinnen der Luisenschule mehrfach zur Aufführung brachten.