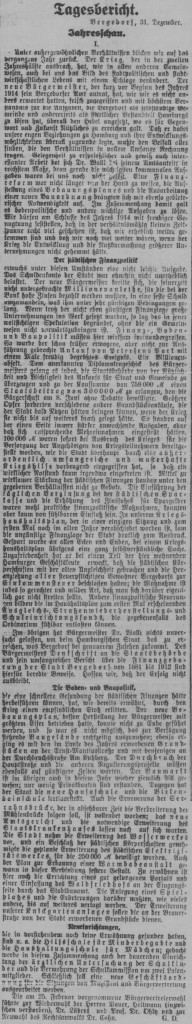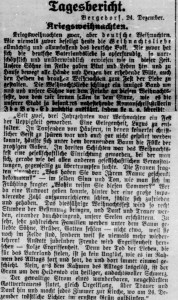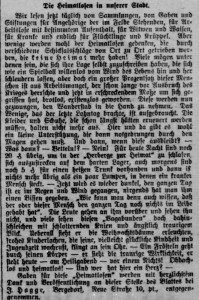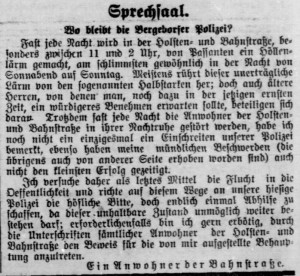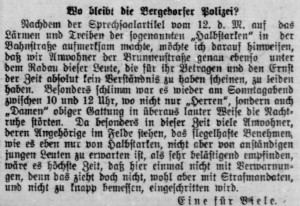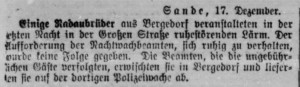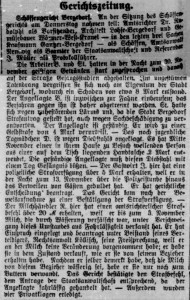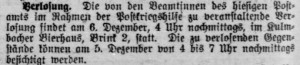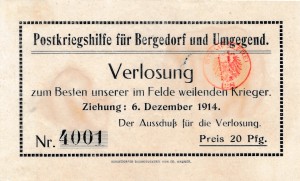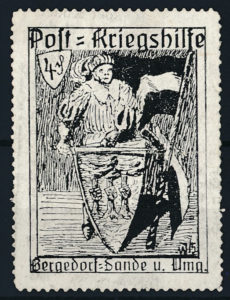Auf dem „platten Land“, wie es im Artikel heißt, war die Jugendwehr offenbar ein Flop, wie auch schon im Beitrag Die Jugendwehr: Papier und Praxis geschildert wurde, aber hier werden verschiedene Gründe dafür genannt: zum einen gab es im Gegensatz zu Bergedorf kaum Jugendvereine, die zur kollektiven Überführung in die Jugendwehr hätten genutzt werden können – das ländliche Vereinsleben fand vor allem in einer Vielzahl von Tierzucht- und Gesangvereinen und in den von Veteranen dominierten Militärvereinen statt – und die Landjugend besuchte höchstens im Winterhalbjahr die Bergedorfer „Fortbildungsschule“, die Vorläuferin der Berufsschule.
Einen weiteren Grund für das Scheitern des Projekts sah der Autor „L.“ im Fehlen geeigneter Übungsplätze: im feuchten Marschboden ließen (und lassen) sich nun einmal keine Schützengräben ausheben, ohne dass sie sich mit Grundwasser füllten – sein Vorschlag, ersatzweise Wandervereine zu bilden, um nach entsprechenden Märschen zur Geest dort „Kriegsspiele“ und „Geländeübungen“ zu veranstalten, wurde „im Keime erstickt“, da die Jugendlichen auch sonntags in der Landwirtschaft benötigt wurden.
Der dritte genannte Grund ist bemerkenswert: „Vielfach ist hier wohl auch die Meinung, daß die Jugend geistig und körperlich für den Dienst im jetzigen Feldzuge bereit gemacht werden sollte.“ Natürlich war dies einer der Hauptzwecke der Jugendwehr, das hatten viele Landbewohner offenbar erkannt, aber „den Ernst und die Bedeutung“ des Projekts hatten sie eben nicht erkannt, und so fehlte es an Unterstützung.
Schließlich das Marschländer „Kastenwesen“: dem Verfasser zufolge waren die gesellschaftlichen Schichten so klar getrennt, dass ein „eng kameradschaftliches“ Miteinander unmöglich war, was die Marschlande von den Vierlanden unterschied. Die soziale Trennung ging in Billwärder sogar so weit, dass es nach Berufsgruppen getrennte Gesangvereine gab, wie Ernst Finder in seiner Studie Die Landschaft Billwärder, ihre Geschichte und ihre Kultur (S. 189) feststellte – in Finders grundlegendem Werk Die Vierlande wurde „keine kastenmäßige Abschließung, keine trennende Kluft“ (S. 131) unter den Vierländern konstatiert.