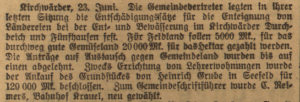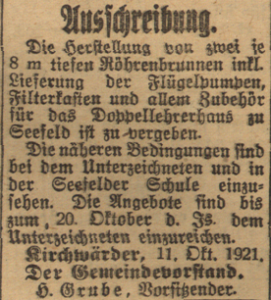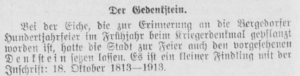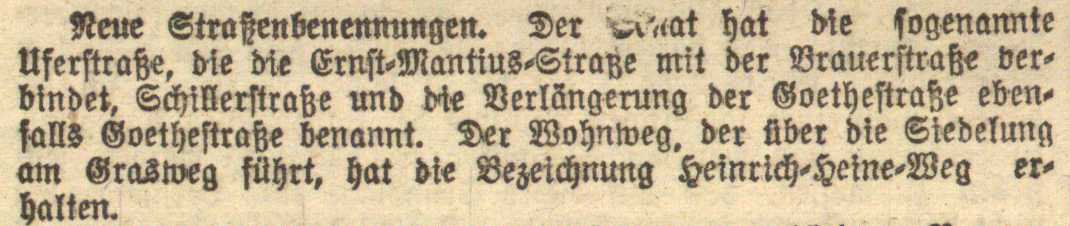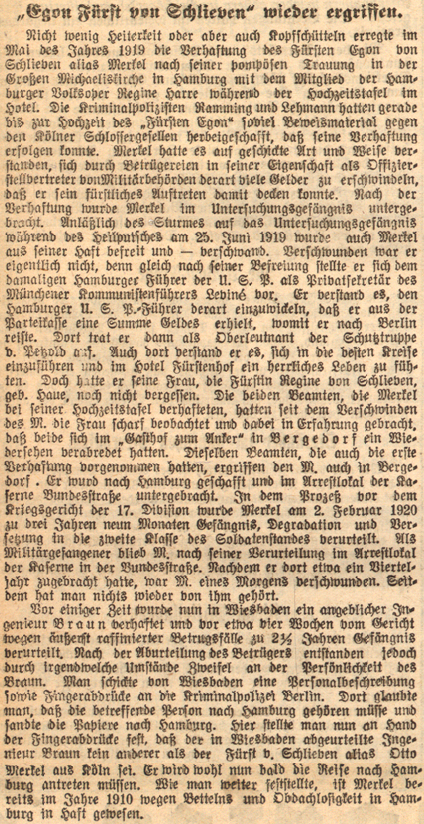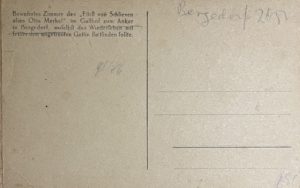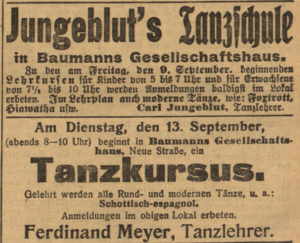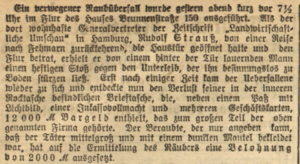Die Flutkatastrophe von 1962 kostete allein in Hamburg über 300 Menschen das Leben, vor allem in Wilhelmsburg und im Alten Land – Bergedorf blieb verschont, aber nur knapp: keine zwei Kilometer vom Bergedorfer Zentrum entfernt stand das Wasser, denn an der Baustelle der Autobahn A1 in Moorfleet hatte der nur provisorisch gesicherte Deich nicht gehalten, auch hatte der Moorfleeter Kanal seine Ufer überstiegen. Das Wasser überflutete Moorfleet, Allermöhe und Billwerder und drang bis zum Oberen Landweg vor – eine Flutmarke am Mittleren Landweg erinnert an den Höchststand.
In den Vierlanden hatten die Deiche Bestand – aber das war nicht immer so gewesen, wie die Bracks hinter den alten Deichen bezeugen, ebenso manche unmotiviert erscheinenden Kurven der alten Deiche; vielfach musste der Deich im Bogen um die Bruchstelle herumgeführt werden, weil die eindringende Flut den Boden tief ausgekolkt hatte.
An einen der schlimmsten Deichbrüche erinnert dieser Gedenkstein an der „Langen Grove“ am heutigen Neuengammer Hauptdeich. Auf einer Strecke von etwa 250 Metern brach der Deich; die Schließung der Lücke konnte nur in einem weiten Bogen erfolgen, dessen rückwärtiger Verlauf noch heute gut erkennbar ist. Erst im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen nach der Flut von 1962 wurde die gerade Deichlinie wiederhergestellt.
1771 war nicht eine Sturmflut die Ursache, sondern eine Unmenge die Elbe herabströmendes Wasser: der Deich brach auf einer Länge von etwa 250 Metern. Nicht nur Neuengamme wurde überflutet, sondern auch die benachbarten Dörfer Kirchwärder, Curslack und Altengamme, teils nach weiteren Deichbrüchen, und so gelangte das Wasser bis fast an die Bergedorfer Kirche, wie Caroline Bergen im Lichtwark Nr. 82 (2021) (S. 6-26) schreibt. Auf einer dort wiedergegebenen historischen Karte (S. 25) ist zu sehen, dass auch die gesamten Marschlande bis vor die Tore Hamburgs überspült wurden.
Schutzdeiche prägten und prägen nicht nur die Vierlande und die Marschlande, auch Bergedorf hatte Deiche zu unterhalten, um den Schleusengraben in seinem Bett zu halten, wie auf der Karte 1875 und der Karte 1904 gut zu sehen ist. Die Karte 1875 zeigt auch, dass der ganze Bergedorfer Kamp eingedeicht war; ein Straßenstummel mit dem Namen Kampdeich erinnert noch daran. Kritisch wurde die Lage für die niedrig gelegenen Teile Bergedorfs immer, wenn die Bille und die Brookwetterung viel Wasser führten und wegen hoher Pegelstände der Elbe die Bergedorfer Schleuse (damals am Kurfürstendeich) geschlossen bleiben musste.
Die Nettelnburg (mit Wehr-, Katen- und Billgrabendeich) hatte immer wieder mit Deichbrüchen zu kämpfen, zuletzt 1930, wie in dem vom Kultur- und Geschichtskontor herausgegebenen Buch Nettelnburg. Ritter, Bauern, Siedler (S. 36ff., S. 112ff.) nachzulesen ist – oder man greift virtuell zur online zugänglichen Bergedorfer Zeitung, die am 24. November 1930 berichtete, dass der „provisorisch hergerichtete Deich“ am neu angelegten Kanal zur Krapphofschleuse nicht standhielt.
Obwohl der Höchststand der Flut vom 16./17. Februar 1962 seitdem mehrfach überschritten wurde, wie die Flutmarken am Zollenspieker Fährhaus, direkt hinter dem Fluttor, belegen, hat der verbesserte Hochwasserschutz bisher ausgereicht, um eine Wiederholung der Katastrophe von 1962 zu verhindern.
Nachklapp:
Zwar schrieb kürzlich eine renommierte Hamburger Wochenzeitung, dass 1962 die Deiche „in Cranz, Neuenfelde, Neugraben und Kirchwerder“ an vielen Stellen brachen, was Jahrzehnte zuvor schon eine auflagenstarke Hamburger Tageszeitung und eine andere Tageszeitung mit Hamburg-Teil vermeldet hatten, doch in Kirchwerder brachen die Deiche zum Glück nicht, wie der Verfasser aus eigener Anschauung weiß. Der angeblich in Neugraben gebrochene Deich existierte und existiert nur in Zeitungsartikeln. Hoffentlich wird er nie vermisst.