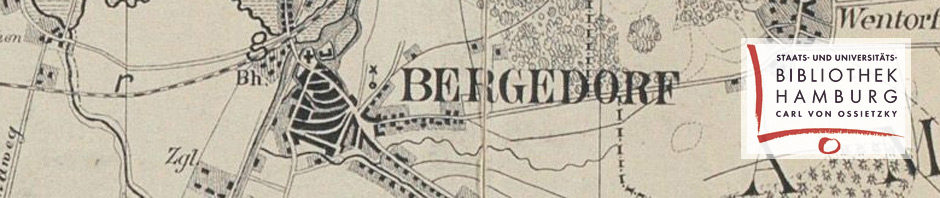Wo ein Höchstpreis ist, da findet sich auch ein Weg zu seiner Umgehung, wie schon im Beitrag Kreativer Umgang mit Höchstpreisen zu lesen war. Bereits im Frühjahr 1917 hatte die BZ das „unlautere Manöver“ angeprangert, dass ein Hersteller oder Erzeuger eines solchen Gutes dieses zunächst an einen Hausangehörigen (zum Erzeugerhöchstpreis) verkaufte, der es dann zum Großhandelshöchstpreis abgab (BZ vom 29. März 1917) – die Differenz konnte über 75 Prozent betragen, wie aus der unten wiedergegebenen Bekanntmachung zu errechnen ist.
Eine der Ideen des Herbstes war der „Kurzkohl“: kleingehackte Grünkohlstrünke mit etwas Blattwerk vermischt, verkauft zu „übermäßigen Preisen“. Die Empfehlung der Zeitung war, den Grünkohl selbst zu schneiden, denn aus „zarten, weichen Strunken“ lasse sich eine „schmackhafte Suppe“ zubereiten. Dass dies tatsächlich möglich ist, zeigt die Speiseordnung eines Armenhauses von 1708 (siehe den Aufsatz von Barbara Krug-Richter in Kulturhistorische Nahrungsmittelforschung, Festschrift für G. Wiegelmann, S. 188), und Frage 10 des Quiz zum Kohl zu den 30. Dithmarscher Kohltagen der shz setzt „Kurzkohl“ und „Grünkohlsuppe“ gleich. Für die Vierlande berichtet Ernst Finder, dass dort der „kurze Kohl“ so fein sein sollte, „daß man ihn durch einen Strohhalm blasen konnte“ (S. 152). Es gab ihn als Morgengericht mit verschiedenen fleischlichen Beigaben.
Erfindungsreichtum gab es auch beim Spinat: es wurden angeblich „erst jetzt während des Krieges“ entdeckte Sorten in den Handel gebracht, nämlich „Dolden- oder Pollspinat, auch Büntzelspinat genannt“. Für den Suchbegriff Doldenspinat geben mehrere Internetseiten an, dass es sich dabei um Giersch handelt und Giersch ähnlich wie Spinat zubereitet werden kann. Ob Büntzelspinat mit dem bei Ch. F. Hochstetter (S. 123f.) genannten Wasser-Bunzelkraut („in einigen Gegenden als Salat benützt“) oder Acker-Bunzelkraut identisch ist, war nicht zu klären; junge Rapspflanzen waren schon im Beitrag über Wildgemüse als Spinatersatz genannt worden – all dies zeigt, dass es sich nicht um Neuentdeckungen handelte, sondern eher um Wiederentdeckungen mit Neubezeichnungen, die zusätzliche Einnahmen versprachen.
Einen vergleichbaren Etikettenschwindel gab es beim „deutschen Tee“ aus einheimischen Kräutern. Zwar gab es hier nur „Richtpreise“, die den örtlichen Behörden Zuschläge ermöglichten (BZ vom 9. Juli 1917), aber wer über die Obergrenze hinauswollte, musste sich etwas einfallen lassen: Brombeer-, Himbeer- und Erdbeerblätter wurden als „Medizinaltee“ teurer verkauft, da sie ja angeblich Heilwirkung hatten und darum mehr waren als ein beliebiges Heißgetränk. Ein administratives Vorgehen gegen diese Praxis wie beim Spinat gab es aber offenbar nicht, sondern nur die redaktionelle Aufforderung: „Solchen Versuchen unberechtigter Preisforderung ist mit Entschiedenheit entgegenzutreten.“ (BZ vom 12. Dezember 1917).