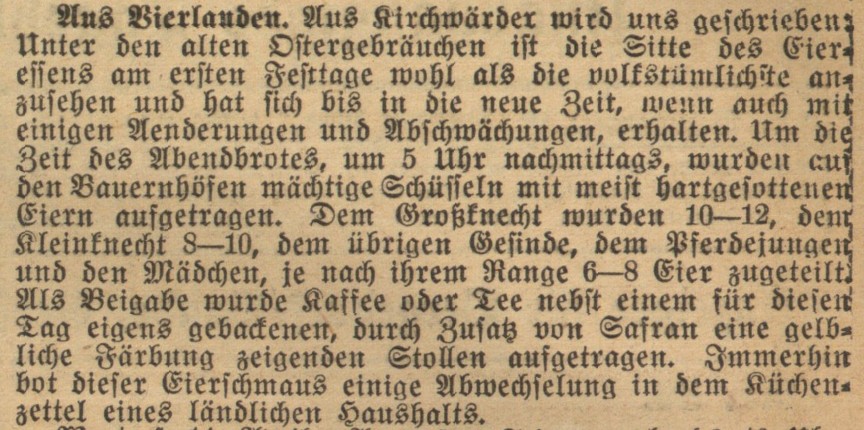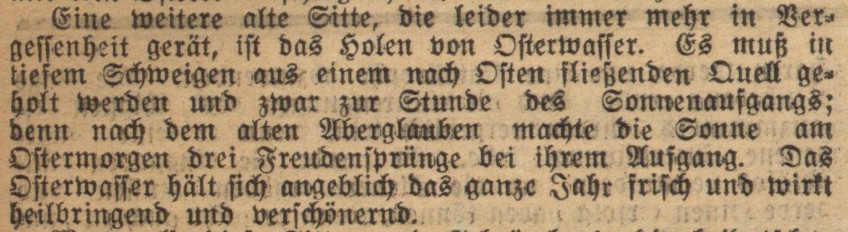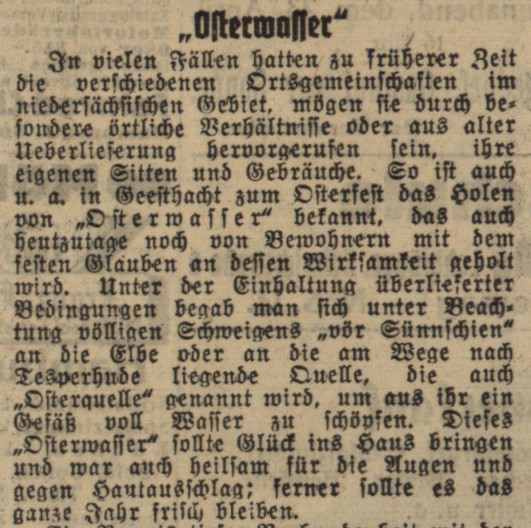Der Zuschrift nach gab es für das „Gesinde“ auf Vierländer Bauernhöfen zu Ostern hartgekochte Eier in beachtlicher Zahl, streng hierarchisch abgestuft und nichts für menschliche Weicheier – aber war das vor hundert Jahren wirklich noch so?
Belege sind kaum zu finden – lediglich bei dem Volkskundler Ernst Finder, Die Vierlande, Band 2, S. 199, wird diese (Un-)Sitte beschrieben, wobei nicht klar ist, ob er die Gegenwart (frühes 20. Jahrhundert) oder die Vergangenheit (19. Jahrhundert) darstellt: auf manchen Höfen durfte jeder „nach Können und Vermögen essen … Bei solchem Eieressen hat mancher, um als fixer Kerl zu gelten, unter Schädigung seiner Gesundheit dreißig Eier und mehr, die ersten sogar mit der Schale gegessen. Todesfälle infolge solcher Unmäßigkeit sind mehrfach bezeugt.“
Die Bergedorfer Zeitung berichtete zwar immer wieder über Osterbräuche, doch bis auf eine Ausnahme (s.u.) ohne jeden Bezug zu ihrem Verbreitungsgebiet: sie übernahm wohl Texte, deren Herkunft nicht recherchiert wurde, die aber katholischen Gegenden entstammten: die Weihung von Palmzweigen (BZ vom 4. April 1925) ist ein bis heute praktizierter katholischer Brauch; für protestantische Gebiete wurden keine Belege gefunden (vgl. Finder, a.a.O., S. 196).
Das „Osterwasser“ wiederum wurde wohl deutschlandweit geschöpft, wenn auch mit kleinen Unterschieden. Zwar stand in der BZ zu lesen, dass das Wasser aus einem nach Osten fließendem Quell geschöpft werden musste – einen solchen Quell gab und gibt es in ganz Vierlanden nicht, dennoch wurde dort Wasser vor Sonnenaufgang schweigend geschöpft. Legt man die Darstellungen in der BZ über die Jahrzehnte nebeneinander, so sollte das von Mädchen und Frauen gewonnene Wasser mal die Schönheit erhalten, mal zur Schönheit verhelfen, mal sollte es heilkräftig sein; mancherorts beteiligten sich auch Burschen und es durfte immerhin gesungen werden (BZ vom 16. April 1892, 16. April 1905, 27. März 1910 und 19. April 1914; siehe auch Finder, a.a.O., S. 199f.). Allerdings hatte Johann Friedrich Voigt in den Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte, [1. Bd,] 2.1880, S. 31, schon Jahrzehnte vorher konstatiert: „Der Glaube an die Heilkraft des am Ostersonntag vor Sonnenaufgang in aller Stille geschöpften Wassers scheint in der Umgegend Hamburgs fast vollständig verschwunden zu sein.“
Nichtsdestotrotz: 1938 schrieb die BZ, dass in Geesthacht Osterwasser „auch heutzutage noch von Bewohnern mit dem festen Glauben an dessen Wirksamkeit geholt wird.“ Doch die weitere Schilderung des Rituals ist im Präteritum geschrieben: man „begab sich“ an die Elbe oder eine Quelle, denn das Wasser „sollte Glück ins Haus bringen und war auch heilsam für die Augen und gegen Hautausschlag; ferner sollte es das ganze Jahr frisch bleiben.“ (BZ vom 16. April 1938) Das war also kein Augenzeugenbericht.