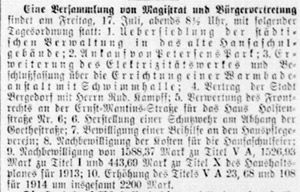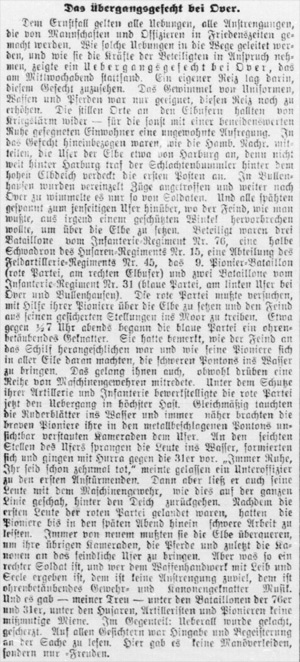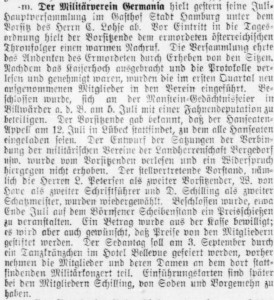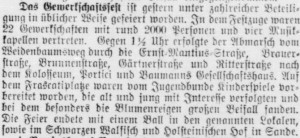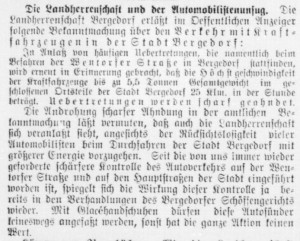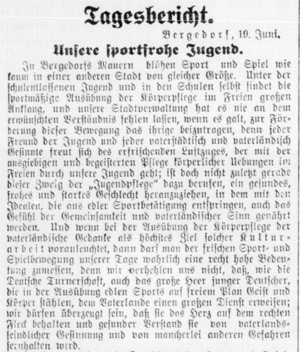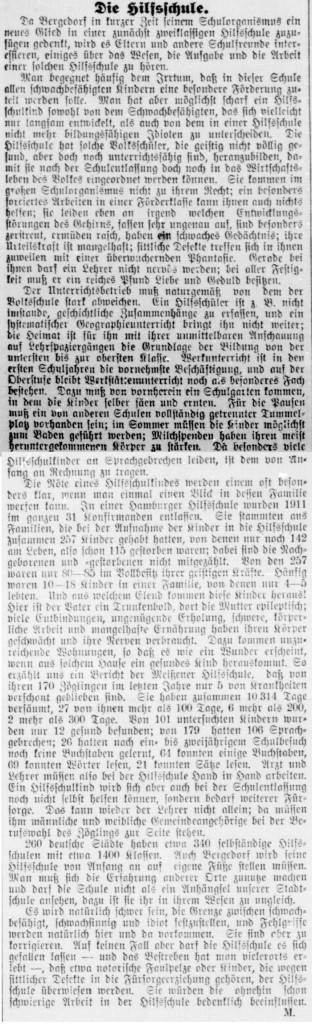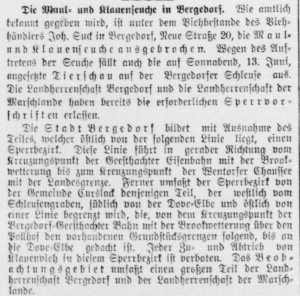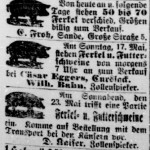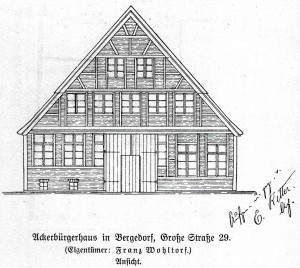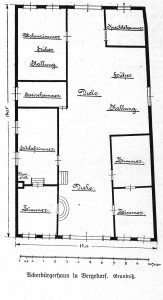Für alle, die heute in Hamburg leben, ist sauberes Wasser eine Selbstverständlichkeit – doch vor einhundert Jahren war die Hamburger Cholera-Epidemie des Jahres 1892 noch im allgemeinen Gedächtnis. Erst in den Jahren und Jahrzehnten nach der Epidemie waren erhebliche Anstrengungen unternommen worden, die Hamburger „Stadtwasserkunst“ auf den Stand der Zeit zu bringen und vom ungefilterten Elbwasser auf Grundwasserförderung und –aufbereitung überzugehen. Bergedorf war damals von der Hamburger Wasserversorgung unabhängig: seit 1898 kam das Wasser nicht mehr aus der Bille (mit anschließender Sandfilterung), sondern aus eigens gebohrten Brunnen – detaillierte Informationen über die Entwicklung der Wasserversorgung in Hamburg und seinen Vororten sind auf der Website von Hamburgwasser nachzulesen.
Die im ersten Absatz des Zeitungsartikels genannten „Kirchwärder Brandstätten“ waren nicht einmal drei Wochen vorher bei einem Großfeuer auf dem „Hitscherberg“ entstanden, das zwölf (zumeist reetgedeckte) Häuser und auch Nebengebäude vernichtete – mangels Wasserleitung musste das Löschwasser aus der 300 Meter entfernten Gose-Elbe herbeigeschafft werden.
Letztlich kam das hier beschriebene geplante Wasserwerk nicht nach Kirchwerder; ob die Grundstückspreise den Ausschlag gaben oder die Ergebnisse der Probebohrungen – 1928 nahm das Wasserwerk Curslack den Betrieb auf.